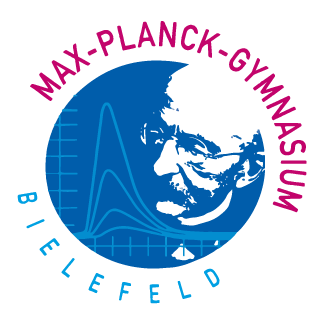von Paula García Młynarska
Anmerkung: Damit der Text angenehmer und leichter zu lesen ist, habe ich an vielen Stellen nur die männliche Form genutzt. Das hat wirklich keinen anderen Grund und die Form steht natürlich stellvertretend für beide Geschlechter.
Jedes Schuljahr haben vier bis fünf Schülerinnen und Schüler des zehnten Jahrgangs unserer Schule die Möglichkeit, zwei Monate lang das Schulleben unserer Partnerschule in Amerika, der „Goshen High School“, zu erleben und bei einer Gastfamilie zu wohnen. Goshen ist eine kleine Stadt im Bundesstaat Indiana und befindet sich unter anderem in der Nähe von Chicago. Organisiert wird dieser Austausch von Herrn Fischer und Herrn Balkenohl, die eng mit Deutschlehrern von der amerikanischen Schule zusammenarbeiten.
Ich bin eine von den fünf Schülerinnen, die letztes Jahr, 2019, an dem Austausch teilgenommen haben. Dieser Artikel handelt von meinen Eindrücken und Erfahrungen, die ich auf der einen Seite in der Schule, und auf der anderen im alltäglichen Leben sowie auf Ausflügen mit meiner Gastfamilie, gesammelt habe. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass ich aus meiner ganz persönlichen Sichtweise schreibe und “nur” in einer Stadt und somit auch in einem Staat von Amerika gelebt habe und zur Schule gegangen bin. Dieser Text ist also keineswegs zu verallgemeinern und auf ganz Amerika zu beziehen. 🙂
Bevor ich den Austausch gemacht habe, hatte ich so gut wie keine Vorstellung von Amerika, da meine einzigen Informationsquellen einzelne High-School-Filme und Bücher waren.
Trotzdem war für mich ziemlich schnell klar, dass ich mich für den Austausch bewerben möchte, einerseits aufgrund der Möglichkeit, mein Englisch verbessern zu können und andererseits weil Amerika, auch wenn ich nie ein wirklich genaues Bild vor Augen hatte, mich schon immer gereizt hat und ich wusste, dass ich das Land sehr gerne mit eigenen Augen sehen würde. Vielleicht lag der Reiz auch gerade darin, dass ich einzelne Bilder im Kopf hatte und vor Ort sehen wollte, wie sich alles zu einem großen Ganzen zusammenfügt.
Das Schulsystem
Auch von dem amerikanischen Schulsystem wusste ich nichts, wenn man von Klischees über Cheerleader, Football-Spieler und Musicals absieht. Jetzt kann ich sagen, dass sich die „Goshen High School”, die mit ihren circa 1.945 Schülerinnen und Schülern mehr als doppelt so groß ist wie das MPG, in vielen Aspekten von unserer Schule unterscheidet. Angefangen damit, dass die Schülerinnen und Schüler erst eine Grundschule, anschließend eine “Middle School” und schlussendlich von der neunten bis zur zwölften Klasse eine High School besuchen. Es gibt sogar besondere Bezeichnungen für die einzelnen Jahrgangsstufen, losgehend bei Freshman, woraufhin man erst zum Sophmore, dann zum Junior und als letztes zum Senior wird. Auf mich wirkte die Grundstimmung in der Schule von Anfang an ganz anders, da keine unterschiedlichen Altersgruppen und sich in ganz verschiedenen Entwicklungen befindenden Personen aufeinandertreffen konnten, was irgendwie zu einem reiferen Eindruck führte, obwohl das in der Praxis auch nicht immer stimmte.
Ein weiterer elementarer Punkt ist, dass man keinen Unterricht im Klassenverband, beziehungsweise keine Stammkurse wie in der zehnten Klasse bei uns, hat. Jeder Schüler bekommt seinen Individuellen Stundenplan, den er ähnlich wie bei uns, aus Pflicht- und Wahlfächern zusammenstellen kann.
Allerdings gibt es eine “Lernstunde” als festes Unterrichtsfach, in der man Hausaufgaben und Projekte erledigen soll. Für gewöhnlich hat man diesen Unterricht in den vier Jahren an der High School durchgehend mit den gleichen Mitschülern und dem gleichen Lehrer. Diese Lehrkraft ist für die Schüler in seiner Gruppe der Ansprechpartner, “guidance counselor” genannt, und begleitet sie bis zum Schulabschluss. So entstehen doch Gemeinschaften, denen man sich zugehörig fühlen kann und man hat immer die Möglichkeit für individuelle Beratung, auch im Hinblick auf die Pläne nach der Schule. Dieses Konzept sagt mir zu, denn so hat man viele Freiheiten bezogen auf den Stundenplan, es ist aber trotzdem immer jemand da, der die Schüler im Einzelnen unterstützt und es ist gesichert, dass die Hausaufgaben gemacht werden, da man sich in der Unterrichtsstunde gezwungenermaßen damit beschäftigen muss.
Wir Austauschschülerinnen wurden zudem individuell von zwei Deutschlehrern der Schule begleitet, an die wir uns immer wenden konnten und die ein spezielles Programm für uns vorbereitet hatten, in dem wir mehr über die amerikanische Kultur lernen, und uns über die Erlebnisse in unseren Gastfamilien austauschen konnten.
Ein anderer grundlegender Unterschied ist die Stundenplanung: Am Montag hat man jedes Fach, das man belegt hat, für jeweils 47 Minuten. An den anderen vier Tagen findet abwechselnd jeweils eine Hälfte der gewählten Fächer statt, wobei diese länger als montags unterrichtet werden, was dazu führt, dass an allen Tagen fast zur gleichen Zeit, um 15.40 Uhr Schulschluss ist. Zudem sind die Pausen anders gelegt: Während wir zwei Pausen à 20 Minuten und eine lange Mittagspause haben, gibt es dort nach jeder Stunde eine fünf- bis siebenminütige Pause, abhängig vom Tag, und eine Mittagspause, die eine halbe Stunde lang ist. Diese Mittagspause findet in einer Unterrichtsstunde statt. Die betroffene Stunde ist 30 Minuten länger als sonst, und je nachdem, ob man A, B, C oder D-Lunch hat, geht man am Anfang, am Ende oder mitten in der Stunde in die Cafeteria, wo Essen gekauft werden kann. Das schmeckt leider den meisten nicht wirklich gut, weshalb viele Schüler Lunch-Pakete von zu Hause mitbringen. Am Anfang ist es definitiv eine Umstellung, den Unterricht zu unterbrechen, um essen zu gehen, und ihn danach fortzuführen, aber ich habe mich schnell daran gewöhnt. Vor allem, wenn ich das Thema interessant fand, konnte ich mich schon während des Essens darauf freuen, weiterzuarbeiten.
Auch das Fächerangebot ist anders und viel breiter aufgefächert als an unserer Schule, was vermutlich auch mit der Größe der beiden Schulen zu tun hat. Das Fach Mathe beispielsweise ist in unterschiedliche Kurse aufgeteilt, darunter befinden sich Algebra und Geometrie. Ähnlich ist das auch bei dem Fach Kunst: Keramik und Zeichnen sind zwei der künstlerischen Fächer. Außerdem gibt es Schulfächer, die bei uns gar nicht angeboten werden, wie zum Beispiel Wirtschaft, “Leben als ein Erwachsener” oder die Mitarbeit an dem eigenen Fernsehsender der Schule, der innerhalb einer bestimmten Saison täglich über Neuigkeiten aus der Schule berichtet. Trotzdem ist die Wahl selbstverständlich nicht komplett einem selbst überlassen. So ist es zum Beispiel wichtig, dass man sich früh Gedanken darüber macht, was man später an einem College studieren möchte. Hierfür muss man teilweise schon an der High School relevante Kurse belegen.
Die Vielfalt der Fächer hat mir definitiv gut getan und ich habe es genossen im Keramik-Unterricht zu töpfern oder in “US Government” alles Wichtige über die amerikanische Regierung zu lernen. Auch das Orchester und andere Musikensembles können als Unterrichtsfach belegt werden - meiner Meinung nach ein gutes Konzept, da man die Möglichkeit hat, ein Instrument zu erlernen und dieses Hobby in seine Bewertung einfließen zu lassen.
Einige Fächer finden zudem jahrgangsstufenübergreifend statt, was dazu geführt hat, dass ich als Zehntklässlerin auch Unterricht mit Elft- und Zwölftklässlern hatte.
Der Unterricht an sich sieht ebenfalls anders aus: Ein wichtiger Punkt ist, dass jeder Schüler einen Laptop von der Schule bekommt, der auch mit nach Hause genommen wird. Darauf können Hausaufgaben gemacht werden und anschließend direkt elektronisch bei dem Lehrer eingereicht werden. Auch im Unterricht wird viel damit gearbeitet, und sogar Tests und Klassenarbeiten werden oft darauf geschrieben. Diese Prüfungen sind meiner Meinung nach einfacher als die an unserer Schule und sie dauern außerdem nicht so lang. Sie bestehen meist sowohl aus Multiple-Choice- als auch aus Schreibaufgaben, wobei Erstere definitiv überwiegen. Und wenn man eine Prüfung nicht bestanden hat oder nicht zufrieden mit der Note ist, kann man sie wiederholen, soviel ich mitbekommen habe, so oft man möchte. Nach Prüfungen oder bei abgegebenen Hausaufgaben, trägt der Lehrer die Note direkt in ein Online-System ein, das sofort eine aktuelle Note aus allen bisherigen Teilleistungen bildet. So hat jeder Schüler zu jeder Zeit Zugang zu seinen Noten und kann nachvollziehen, wie diese sich zusammensetzen. Meist wissen die Lehrer gar nicht, welche Note der Schüler aktuell hat, denn mündliche Mitarbeit wird nicht bewertet. Es gibt zwar neben Prüfungen und Hausaufgaben eine Kategorie in der Bewertung, die “Unterrichtsmitarbeit” heißt, damit ist allerdings gemeint, ob man gut auf die Stunde vorbereitet ist, mitarbeitet und nicht negativ auffällt. Ich persönlich finde es besser, wenn auch die mündliche Mitarbeit bewertet wird, denn das zwingt den Schüler zum Mitdenken und dazu, sich mit dem Unterrichtsthema auseinanderzusetzen. Vor allem haben mir anregende Unterrichtsdiskussionen gefehlt und es schien mir manchmal, dass einige Schüler ganz vergessen hatten, dass sie sich gerade in der Schule befanden. Das kann bei uns natürlich auch passieren, es ist hier aber viel schwieriger, sich den Erwartungen des Lehrers zu entziehen. Die meisten amerikanischen Lehrer haben zwar versucht, ihre Schüler mit in den Unterricht einzubeziehen, sind aber oft gescheitert oder mussten ihre Frage mehrmals wiederholen, bis jemand darauf geantwortet hat. Mir wurde ziemlich schnell klar, dass man sich im Unterricht also keine Sekunde lang konzentrieren muss und trotzdem ein A, die beste Note, bekommen kann, solange man alle Aufgaben pünktlich einreicht, die mit Hilfe des Internets auch nicht allzu viel Zeit in Anspruch nehmen sollten, und für die Prüfungen lernt.
An dieser Stelle hat mir wirklich etwas gefehlt, da ich nicht das Gefühl hatte, durch diese Methode wirklich gut lernen und den Unterrichtsstoff aufnehmen zu können, der mir zusätzlich auch noch sehr viel weniger anspruchsvoll erschien.
Neben der mündlichen Mitarbeit hat mir vor allem die Ebene der eigenen Interpretation und Bewertung gefehlt, da die persönliche Meinung zu bestimmten Themen zwar angegeben werden konnte, ich aber nie mitbekommen habe, dass diese wirklich erklärt werden sollte. Meiner Meinung nach ist gerade die Fähigkeit der eigenen Meinungsbildung und die damit verbundene immer größer werdende Selbstständigkeit eine der wichtigsten Kompetenzen, die eine Schule an ihre Schüler vermitteln sollte.
Was mir am Unterricht allerdings besonders gefallen hat, ist, dass die Lehrer oft vorbereitete Kopien austeilen, die schon einige Schlagwörter aufzeigen und die Struktur der Notizen vorgeben, die der Schüler aber im Endeffekt selbst ausfüllen muss. Ich denke, dass das den Schüler auf der einen Seite zum aktiven Mitschreiben bringt, und andererseits sowohl dem Schüler als auch dem Lehrer die Sicherheit gibt, dass der Schüler auch das wirklich wichtige und für Prüfungen relevante notiert hat.
Und auch die Unterrichtsstunden bestehen nicht nur aus einseitigem Frontalunterricht, es wird zum Beispiel in Gruppen an Projekten gearbeitet oder an den Laptops recherchiert beziehungsweise gelernt. Im Spanischunterricht wurde zum Beispiel viel mit Onlinespielen zum Lernen von Vokabeln oder Grammatik gearbeitet, die unsere Lehrerin selbst erstellt hatte. Und am Anfang jeder “US Government”-Stunde hat die Klasse gemeinsam die Nachrichten geschaut.
Eine andere interessante Charaktereigenschaft der amerikanischen Schule, die ich beobachtet habe, ist das sehr viel gelassenere Verhältnis von Lehrern zu Schülern. Während bei uns zumeist eine gewisse Distanz zwischen Schüler und Lehrer herrscht, begrüßen sich an der High School Schüler und Lehrer auf dem Flur mit einer Bro Fist oder machen Witze übereinander, wobei es in beiden Ländern selbstverständlich von Person zu Person anders aussieht.
Ein weiterer wichtiger Unterschied ist, dass man das Schulgelände nicht verlassen darf. Es gibt eine Tür, zu der morgens jeder reinkommen muss, und dort wird kontrolliert, ob alle Schüler eine ID um den Hals tragen. Diese ID ist zu vergleichen mit unseren Schülerausweisen, mit dem einzigen Unterschied, dass man sie immer bei sich haben und an einem Band sichtbar um den Hals tragen muss. Auch in der Mittagspause muss man sich in der Cafeteria oder im Forum aufhalten, sogar das Betreten der Schulflure ist dann verboten. Und selbst wenn man den Klassenraum während des Unterrichts verlässt, um beispielsweise auf die Toilette zu gehen, muss der Lehrer einen unterschriebenen “Flur-Pass” ausstellen.
Dies alles soll selbstverständlich die Sicherheit an der Schule erhöhen. Doch ich muss sagen, dass ich mich manchmal sehr stark kontrolliert gefühlt habe.
An einem Tag waren sogar Polizisten in der Schule stationiert, da Amoklaufgefahr aufgrund einer anonymen Botschaft auf einer Toilettenwand bestand, die sich später aber als ein blöder Scherz herausstellte. Ich muss sagen, dass ich den ganzen Tag über ein mulmiges Gefühl im Magen hatte und unsicher war, ob es eine gute Idee gewesen war, zur Schule zu gehen.
Für die Mitschüler und Lehrer, mit denen ich mich darüber unterhalten habe, war das Phänomen einer solchen Drohung nicht ungewöhnlich, was auf mich erschreckend, aber trotzdem irgendwie auch beruhigend wirkte. Dieses Erlebnis hat mir vor Augen geführt, wie glücklich ich mich schätzen kann, in einem Land zu leben, in dem es nur nötig ist, in Schulen das Verhalten im Fall von Feueralarm zu üben und nicht bezogen auf einen Amoklauf.
Solche großen politischen Unterschiede können sich ganz unabhängig von der Lebensweise einer Person sehr stark auf ihr Leben auswirken.
Ein anderer wirklich grundlegender Kontrast zu Deutschland ist, dass es in Indiana schon mit 16 Jahren möglich ist, den Führerschein zu machen, weshalb viele Schüler mit dem Auto zur Schule kommen. Das kann man als typisch für Amerika bezeichnen. Für Schüler, die mehr als eine Meile, was ungefähr anderthalb Kilometer sind, von der Schule entfernt wohnen, gibt es aber auch die Möglichkeit, mit Schulbussen zu fahren, die ebenfalls in ihrem typischem Gelb durch die Straßen fahren.
Da High Schools normalerweise Ganztagsschulen sind, gibt es ein breit gefächertes Angebot an Arbeitsgemeinschaften, sogenannten Clubs. Wir deutschen Austauschschülerinnen waren zu einem Treffen des German Club eingeladen, wo Deutschschüler über unsere Kultur lernen und sich austauschen, um ein Beispiel zu nennen.
Ein ebenfalls sehr beliebtes Angebot der Schule sind die verschiedenen Sportteams, die von Wrestling über Basketball bis hin zu Cheerleading reichen. Wer Mitglied in einem der Teams ist, muss den normalen Sportunterricht der Schule nicht besuchen, hat dafür aber mehrmals in der Woche ein intensives Training. Meine Austauschschülerin spielt zum Beispiel Tennis und musste auch außerhalb der Saison zum Stabilisationstraining. Der Sport macht ohne Zweifel einen großen Teil der High School aus und sie scheint sich in gewissem Maße durch die Stärke ihrer Teams zu definieren.
Die Mentalität an der Schule
Um von der akademischen und organisatorischen Seite der Schule zur dort vorherrschenden Mentalität und dem zwischenmenschlichen Aspekt überzugehen, sind die Basketballspiele die perfekte Brücke.
Die großen Sportevents sind vermutlich etwas, womit fast jeder eine amerikanische High School verbindet. Und das auch zu Recht: Ich habe drei Basketballspiele miterlebt, die wirklich überwältigend waren. Sehr viele Schüler, Lehrer und Eltern sind gekommen, um das Team anzufeuern und zu unterstützen. Jede dieser Gruppen hat seine eigene Zuschauertribüne in der Sporthalle und in jedem einzelnen Teil war die Stimmung sehr intensiv. Sprechgesänge waren keine Ausnahme und, egal, ob das Team am gewinnen war oder zurücklag, ich habe immer ein starkes Gemeinschaftsgefühl zwischen den Zuschauern untereinander, aber auch mit dem Team wahrgenommen. Das begann schon bei der “Pledge of Allegiance”, dem Treuegelöbnis für die Nation vor der amerikanischen Flagge. Der Fanblock des gegnerischen Teams wurde zum verfeindeten Lager und die gesamte Konzentration des Raumes schien sich in der Mitte, auf dem Spielfeld, zu ballen. Die Spiele konnten so spannend werden, dass ich so sehr mitgefiebert habe, wie ich es vorher noch nie erlebt habe. Die Wut, die Erleichterung, die Freude, begleiteten mich oft bis in den Abend. Die Cheerleader, die den Anschein hatten einem High-School-Film entsprungen zu sein, haben die Emotionen und das Gefühl der Zugehörigkeit in ihren Auftritten vor, während und nach dem Spiel, noch verstärkt. Als Komplettierung des Spektakels diente zudem die Marching Band der Schule, ein riesiges Blasorchester mit Percussionbegleitung.
Der eigentliche Schulalltag steht in Teilen allerdings im Gegensatz zu dem Zusammengehörigkeitsgefühl während der sportlichen Ereignisse. So habe ich mitbekommen, dass es eine starke Gruppenbildung gibt. Zwischen diesen Gruppen gibt es allem Anschein nach wenig Austausch, was wahrscheinlich auch dem Kurssystem geschuldet ist, dass es nicht wirklich erlaubt, sich mit jemandem außerhalb des Freundeskreises intensiver zu beschäftigen. Trotzdem wirkte der Umgangston meist freundlich, aber oft auch oberflächlicher als bei uns.
An mir als Austauschschülerin waren einige Schülerinnen und Schüler sehr interessiert und wollten etwas über mich und über Deutschland erfahren. Dabei habe ich festgestellt, dass es viele amerikanische Jugendliche gibt, die kein anderes Land als ihres kennen. Einige sind in einem wirklich nur sehr geringen Maße über den Rest der Welt aufgeklärt, was mich manchmal zum Stutzen gebracht hat. Ich denke, dass das aber auch viel mit der Größe von Amerika zu tun hat.
Ich habe zwar im Unterricht schnell Menschen finden können, mit denen ich mich unterhalten und zusammen arbeiten sowie mittagessen konnte, ich denke aber, dass es auf Dauer schwieriger für mich geworden wäre als in Deutschland wirkliche Freundschaften zu knüpfen, da wie ich es empfunden habe, eine gewisse Oberflächlichkeit zwischen den Menschen besteht, die erst mit der Zeit überwunden werden kann.
Die dadurch entstehende allgegenwärtige Freundlichkeit führt dazu, dass sich die Schüler und Schülerinnen untereinander sehr viel mehr Komplimente geben, die sich allerdings oft eher unpersönlich auf das äußere Erscheinungsbild der Person beziehen, und auch die Frage “How are you doing?” ist vielmehr als eine nette Begrüßung zu verstehen, die keine ehrliche Antwort erwartet und erwünscht.
Ich denke, dass die wirkliche Persönlichkeit eines Menschen in der amerikanischen Schule und Kultur erst später zum Vorschein kommt, dafür aber viel mehr Herzlichkeit zu finden ist.
Fazit zum Schulleben
Abschließend kann ich sagen, dass die Schule an vielen Stellen so ist, wie ich mir eine amerikanische Schule vorgestellt hatte und wie sie auch in Filmen dargestellt wird. Dazu gehören beispielsweise die oben beschriebenen Basketballspiele mit Cheerleadern und ganz simpel auch das Gebäude mit all den großen Fluren, Sporthallen und Schließfächern. Was ich allerdings nicht erwartet hätte ist, dass der Unterricht gemessen an unserem sehr viel weniger anspruchsvoll ist. Dafür hat er mir aber fast immer Spaß gemacht und wenn es um die Digitalisierung geht, liegt die High School auf jeden Fall vorne.
Was meine zwischenmenschlichen Erfahrungen angeht, kann ich noch einmal herausheben, dass das Klima zwar ein wenig lockerer war, es aber wie auch hier in Deutschland immer von den Personen abhängt, die dich umgeben, was jetzt zwar wahrscheinlich banal klingt, aber ich denke, dass es wichtig ist das an dieser Stelle herauszustellen, um zu betonen, dass Generalisierungen verbunden mit Vorurteilen in keiner Situation weiterhelfen, sondern ganz im Gegenteil nur behindern. Es ist wichtig, sich auf die Kultur und die Menschen einzulassen, wenn man etwas über sie lernen möchte und man sollte nicht vergessen, dass man der Gast ist und keineswegs den Anspruch haben sollte, dass die Menschen die eigenen Erwartungen erfüllen. Es gab sehr viele Schüler, die wirklich nett waren und mit denen man sich gut unterhalten konnte, auf der anderen Seite gab es aber auch unsympathische. Was das Vorurteil angeht, dass Amerikaner oberflächlicher sind, kann ich sagen, dass es vordergründig zu großen Teilen stimmt, dass eine Freundlichkeit auf Small Talk Basis vorhanden ist, die aber auch nicht auf jeden zutrifft und definitiv nicht das innere der Menschen widerspiegelt, was man feststellen kann, wenn man sie besser kennenlernt.
Als Bildungsinstitution leistet die Schule meiner Meinung nach nicht so viel wie zum Beispiel unsere, was auch von einigen Amerikanern so gesehen wird. Ein Lehrer, mit dem ich mich darüber unterhalten habe, meint, dass man durch den starken sportlichen Aspekt den akademischen schnell aus den Augen verliert, was auch meine Gastmutter, die ebenfalls Lehrerin ist, so sieht. Dafür war die Stimmung einfach lockerer und ich denke, dass deutlich weniger Druck vorhanden ist.
Für mich war der Besuch einer High School definitiv eine gewinnbringende Erfahrung, die mir geholfen hat, mein Wissen zu vergrößern und etwas einzigartiges zu erleben und für zwei Monate eine High-School-Schülerin zu werden, die den Geist dieser Schule fühlt und lebt.
Ausflüge mit meiner Gastfamilie – Highlights beim Besichtigen
Ich hatte das Glück eine sehr nette und offene Gastfamilie bekommen zu haben, die mich herzlich aufgenommen und viel mit mir unternommen hat. Meine Austauschschülerin ist ein Jahr älter als ich und war somit ein Junior (elfte Klasse) während ich ein Sophmore (zehnte Klasse) war. Wir haben uns gut verstanden und viel zusammen unternommen. Auch ihre Eltern und ihre Großmutter, die im gleichen Haus lebt, haben mich nicht nur in das Familienleben mit einbezogen, sondern ebenfalls auf spannende und interessante Ausflüge mitgenommen.
Mein erster großer Ausflug ging nach Indianapolis, die Hauptstadt von Indiana, wo ich das College, an dem eine meiner Gastschwestern studiert, gezeigt bekommen habe. Sie lebt in einem Studentenwohnheim auf dem Campus ihres Colleges und durch eine Führung von ihr habe ich einen guten Einblick bekommen in die einzelnen Gebäudekomplexe, aus Unterrichtsgebäuden, der Kantine, Kiosken, Wohnheimen, Sportplätzen und vielem mehr. Ich habe richtig Lust bekommen, dort zu studieren, denn ich glaube, dass man sich als Student an einem College irgendwie als Teil einer riesigen Familie fühlt. Man wohnt zusammen, lernt zusammen, macht zusammen Sport und hat Spaß. Das Gemeinschaftsgefühl aus der High School muss sich dadurch bestimmt noch verstärken.
Neben dem College haben wir noch viele weitere Punkte in Indianapolis besichtigt, darunter das “Indianapolis Museum of Art”, das eine schöne und interessante Mischung aus moderner und älterer Kunst bietet, einen Aussichtsturm und ein großes Einkaufszentrum. Für mich persönlich war der Höhepunkt aber eindeutig eine Kutschfahrt durch die Innenstadt. Die riesigen Gebäude um mich herum haben mir ein ganz neues Gefühl gegeben, mir vor Augen geführt, wie weit weg ich von zu Hause bin und wie sehr man in der Ästhetik einer Stadt mit all ihren Lichtern versinken kann.
Einen anderen unvergesslichen Tag haben wir in der Millionenstadt Chicago im Bundesstaat Illinois verbracht. Der Bekanntheitsgrad dieser Stadt hat es für mich natürlich noch aufregender und interessanter gemacht, vor allem, weil ich im Gegensatz zu den anderen Orten, schon vorher etwas von ihr gehört und ein ungefähres Bild vor Augen hatte. Nichtsdestotrotz wusste ich nicht, was für eine Größe, die eine andere Dimension zu haben scheint als der Rest der Welt, mich erwarten würde. Meine Eindrücke aus Indianapolis wurden hier noch übertroffen: Als ich aus dem Auto stieg, hatte ich regelrecht den Eindruck, mich in einem Wald aus gigantischen Bauwerken zu befinden, der an vereinzelten Stellen durch große Plätze, Lichtungen, geöffnet wurde. Die Stadt kam mir vor wie ein weit verzweigtes, riesiges Netzwerk aus Wolkenkratzern bis zum Horizont. Noch verstärkt wurde dieser Eindruck durch den Besuch des “Skydecks”, der 103. Etage des Willis Towers, der mit seinen 527,3 Metern das höchste Bauwerk Chicagos ist und sogar den zwanzigsten Platz in der gesamten Welt hat. Der Blick aus einer Glaskapsel heraus, die einem das Gefühl gibt, keinen Boden unter den Füßen zu haben, ist unbeschreiblich. Vor meinen Augen breitete sich ein Netz aus Gebäuden und Straßen aus, das größer nicht hätte sein können, abgerundet durch das sich weit erstreckende Blau des Lake Michigan.
Auch eine Chicago-Style Pizza darf man sich nicht entgehen lassen: Mit ihrer Höhe gleicht sie vielmehr einer Lasagne, als einer Pizza. In dieser Hinsicht bestätigt sich ein in Deutschland verbreitetes Bild über die amerikanische Esskultur, wobei ich sagen muss, dass das ein typisches Gericht unter vielen ist und dazu auch noch sehr lecker.
Insgesamt kann ich sagen, dass ich den Ausflug nach Chicago so schnell nicht vergessen werde. Zu den geschilderten Eindrücken kam auch noch ein Filmabend in einem IMAX Kino hinzu, welches das Schauen von “Captain Marvel” auf seiner riesigen Leinwand zu einem ganz besonderen Erlebnis gemacht hat, und ein abendlicher Spaziergang inmitten eines starken Regenschauers, der mir vor Augen geführt hat, dass Regen auch schön sein kann.
Ein letzter für mich besonderer Trip ging nach Shipshewana, eine Stadt, die einen wirklich krassen Kontrast zu Chicago und Indianapolis darstellt und trotzdem nicht minder Teil der Kultur der Gegend und weniger sehenswürdig ist. Der kleine Ort liegt in der Nähe von Goshen und ist gut mit dem Auto erreichbar. Schon auf der Fahrt merkt man den Übergang von der Stadt, über vereinzelte Gebäude inmitten von Feldern, bis hin zu weitläufig landwirtschaftlichen Gebieten. Shipshewana liegt mit seinen ungefähr 700 Einwohnern und einer Fläche von 3,46 Quadratkilometern in dieser Gegend. Anders als man denken könnte, hat die Stadt viel Interessantes zu bieten, vor allem, weil ein großer Teil der Einwohner amisch ist.
Die Amish People sind eine aus dem Christentum entstandene protestantische Glaubensgemeinschaft, deren größtenteils aus der Schweiz und Süddeutschland stammende Mitglieder im 18. Jahrhundert begannen, nach Amerika auszuwandern. Ihre Nachfahren leben noch heute in kleinen Gemeinschaften in Amerika und Kanada und bewahren die Bräuche ihrer Vorfahren. In ganz Amerika gibt es um die 241.000 Amish People, wovon 19 Prozent im Staat Indiana leben. Deshalb sind auch im Elkhart County, dem Landkreis von Goshen, vergleichsweise viele Amish People zu finden, 2012 waren es ungefähr 6.244, was etwas mehr als drei Prozent der gesamten dort lebenden Bevölkerung ausmacht. Die Anhänger dieser Gemeinschaft sind streng gläubig, leben nach strikten Regeln, trinken deshalb beispielsweise keinen Alkohol, und nutzen keine Errungenschaften der modernen Welt, wie Strom oder Autos. Viele amische Familien wohnen auf Bauernhöfen und bewegen sich auf Fahrrädern oder Kutschen fort, beides ein eher ungewöhnliches Bild, wenn man den Rest der Bevölkerung betrachtet. Vor einigen großen Discountern gibt es sogar Stellplätze für ihre Kutschen, doch nicht nur beim Einkaufen, sondern auch in anderen alltäglichen Situationen des Lebens, überschneiden sich die Lebensweisen dieser Gruppe mit denen der anderen Einwohner, weshalb ich sie mit ihrer traditionellen Kleidung in Restaurants oder auf der Rodelbahn zu Gesicht bekommen habe.
Außerdem sprechen sie eine Form von Deutsch, Pennsylvania Dutch, das auch englische Ausdrücke beinhaltet und haben ein eigenes Schulsystem, weshalb die Kinder in kleinen amischen Dorfschulen lernen. An einigen Gemeinschaften von amischen Bauernhöfen sind wir mit dem Auto vorbeigefahren und beim Anblick dieser Menschen scheint sich das weit verbreitete Bild von in der Zeit stehen Gebliebenen oder Zeitreisenden aus dem 18. Jahrhundert zu bestätigen, doch so ganz ohne zu bemerken, was in der Außenwelt geschieht, leben sie nicht. Schließlich nutzen sie Supermärkte und gehen in Restaurants essen.
Ein Einblick in das Leben dieser Religionsgemeinschaft in Shipshewana lohnt sich, wobei es meiner Meinung nach auch hier fraglich ist, wie viel in der Stadt wirklich noch den amischen Traditionen entspricht. Es lassen sich viele kleine Läden mit Souvenirs finden, und vor allem mit typischem Essen der Amish People. An der Echtheit der wirklich leckeren Donuts, eingelegten Gurken oder der Apfelbutter und des in allen Geschmacksrichtungen vorhandenen Käses zweifle ich keineswegs, allerdings leben die Amish traditionellerweise ohne Strom und könnten die Läden mit dem Licht und den Kühltheken somit gar nicht betreiben. Auf einer anderen Fahrt aus Goshen heraus, hat mir meine Gastmutter erklärt, wie man eine “echte” amische Farm von den anderen unterscheiden kann und eigentlich ist es ganz einfach: Man muss nur Ausschau danach halten, ob das Haus mit einer Stromleitung verbunden ist oder eben nicht.
Trotzdem hat mir Shipshewana gut gefallen, denn auch wenn ich nicht genau sagen kann, ob alles als amisch titulierte auch wirklich typisch und traditionell amisch war, habe ich echte Amish People gesehen. Und wenn sie etwas an ihrer Lebensweise ändern möchten und beispielsweise beginnen, Strom zu nutzen, muss das ja nicht zwingend als eine Infragestellung ihrer wirklichen Zugehörigkeit zu der Gemeinschaft genutzt werden, denn Traditionen ändern sich mit der Zeit und die Modernisierung ist kein neues Phänomen. Ob man das nun als Grund für einen Vorwurf sieht oder nicht, sei jedem selbst überlassen. Für mich persönlich war der Tag in Shipshewana auf jeden Fall ein Gewinn und mir ist bewusst, dass mich auf einer amischen Farm und Dorfschule ganz andere Eindrücke erwartet hätten.
Aber nicht nur der Bezug zu den Amish People hat die Stadt für mich so sehenswert gemacht, sondern auch ganz schlicht und einfach das Bild, welches sich meinen Augen zeigte. Wie ich vorhin schon beschrieben habe, könnte der Gegensatz zur Großstadt oder Metropole kaum noch deutlicher sein: Das Schlendern in den kleinen Gassen, links und rechts Holzhäuser, in denen sich kleine Shops und Restaurants befinden, hat mir auf seine eigene Art und Weise ein ganz besonders amerikanisches Flair vermittelt. Hier konnte ich die Kultur von einer ganz anderen Seite erleben.
Also, falls ihr mal in Shipshewana sein solltet, empfehle ich euch, auf jeden Fall in die “Risn Roll Bakery” für besonders leckere amische Donuts und die “Heritage Ridge Creamery”, wo es Käse in allen Formen und Farben zum Probieren gibt, zu gehen.
Das Leben in Goshen
Anknüpfend an die Beschreibung dieser beiden Extreme, möchte ich noch etwas genauer auf Goshen und das alltägliche Leben, an dem ich teilhaben durfte, eingehen.
Die Stadt hat in etwa 33.220 Einwohner und eine Fläche von 44.10 Quadratkilometern. Gemessen an den 333.000 Einwohnern und der fast sechsmal so großen Fläche Bielefelds scheint die Stadt auf den ersten Blick bedeutungslos, doch als County Seat von dem Verwaltungsbezirk Elkhart County und Universitätsstadt, hat sie bei mir trotzdem den Eindruck hinterlassen, von Wichtigkeit zu sein.
Neben den vielen Amish People, die in oder in der Nähe von Goshen leben, wohnen dort auch viele Menschen mit lateinamerikanischem Hintergrund. Sie machen ungefähr 30 Prozent der Bevölkerung der Stadt aus. Vor allem aus Mexiko ist die Einwanderungsrate sehr hoch, was für mich etwas paradox war, wenn man bedenkt, dass Indiana ein pro Trump Staat ist. Aus diesem Grund fand ich das Zusammenleben der Kulturen in Goshen sehr schön. Zudem ist natürlich nicht jeder Bewohner ein Republikaner, und auch ein Republikaner nicht gleich ein Rassist.
Die Größe der Stadt hat mir persönlich zugesagt, da sie definitiv nicht zu groß und voll ist, dennoch aber viele Möglichkeiten bietet, sei es im Hinblick auf die Freizeitgestaltung, Bildung oder Anderes. Natürlich habe ich Goshen eher als Besucherin kennengelernt. Allerdings hatte ich den Eindruck, dass die Stadt Einiges für ihre Einwohner bereithält, die somit nicht zwingenderweise für jede größere Besorgung in die nächstgrößere Stadt fahren müssen, wie das “Goshen College”, ein Krankenhaus, eine Bibliothek und Natur mit vielen Seen zum Entspannen.
In dem Zeitraum meines Aufenthaltes dort war es tiefer Winter und wegen einer Kältewelle in Teilen Amerikas konnte es in dem Gebiet um Goshen bis zu minus 30 Grad Celsius kalt werden. Tatsächlich war das aber kein Problem für mich, da ich die verschneite und zauberhafte Landschaft um mich herum, wie man sie in Deutschland nicht mehr zu sehen bekommt, toll fand. Sich viel draußen aufzuhalten war verständlicherweise keine gute Idee, aber im Laufe der Zeit wurde das Wetter wieder milder und der Schnee ist geschmolzen, sodass Spaziergänge oder Ausflüge in die Stadt wieder besser zu machen waren.
Die Innenstadt ist klein, aber schön und gemütlich und ich habe jeden kleinen Ausflug zum Besichtigen, Einkaufen oder Essen gehen genossen und mich gefühlt, als wäre ich in einen Film katapultiert worden, der in einer amerikanischen Kleinstadt mit all ihren Cafés, Kinos und winzigen Shops, spielt.
Die Infrastruktur hingegen, würde man aus deutscher Sicht bezogen auf den öffentlichen Verkehr als schlecht bezeichnen. Wie es für amerikanische Kleinstädte üblich ist, habe ich kein gut ausgebautes Nahverkehrssystem vorgefunden. Außer weniger Busslinien, die selten und unregelmäßig fahren, scheint es in Goshen so gut wie keinen öffentlichen Transport zu geben. Ohne ein Auto ist es also fast unmöglich sich in der Stadt fortzubewegen, was dazu führt, dass fast jeder ein eigenes besitzt. Wie schon angesprochen, fährt die Mehrheit der Schüler mit dem Auto zur Schule; der Parkplatz sieht so voll aus wie der vor einem Einkaufszentrum. Aber nicht nur meine Austauschschülerin hatte ein eigenes Auto. Ihre Mutter, ihr Vater und ihre Großmutter hatten jeweils eins, was im Vergleich zu deutschen Familien, die meist ein oder zwei Autos haben, sehr viel oder fast schon übertrieben erscheint, aufgrund der Infrastruktur in Goshen aber fast unentbehrlich für jemanden ist, der arbeitet und viel unterwegs ist. Dazu kommt, dass man Fahrräder fast gar nicht nutzt, und wenn, dann nur zum Freizeitspaß. Zu Fuß zu gehen schien für die Menschen auch keine Option für kurze Strecken zu sein, was aber bestimmt auch dem Wetter geschuldet war.
Einmal war ich mit meiner Austauschschülerin in einem großen Secondhand-Geschäft, und um nicht zum gegenüberliegenden Supermarkt laufen zu müssen, den nur ein Parkplatz von uns trennte, haben wir das Auto auf dem Parkplatz umgeparkt. In diesem Punkt meine ich eine andere Mentalität als die deutsche kennengelernt zu haben, und so alltäglich dieses Erlebnis auch war, ich werde mein Erstaunen darüber so schnell nicht vergessen.
Das Jugendleben
Mit dem Aspekt der Kultur des Autofahrens geht auch einher, dass Jugendliche damit oft unterwegs sind und sich mit Freunden treffen, um sich etwas zu Essen zu holen oder einfach durch die Gegend zu fahren und die Zeit zu genießen. Oft hat meine Austauschschülerin mich mit Freunden im Auto zu Starbucks oder Target mitgenommen, wo wir viel Spaß hatten. Target ist eine riesige Geschäftskette in Amerika und in den Läden, sogenannten „Grocery Stores“, wird von Essen über Gartenzubehör und Kleidung bis hin zu elektronischen Geräten wirklich alles verkauft. Außerdem gibt es in Amerika sehr viele „Drive Thrus“, bei denen man sich mit dem Auto in einer Schlange anstellt, um Essen oder Getränke zum direkten Weiterfahren zu kaufen.
Ansonsten scheint es mir, dass Jugendliche in Deutschland und Amerika ihre freie Zeit ziemlich ähnlich gestalten, sprich sich zu Hause treffen oder eben etwas unternehmen. Es war definitiv eine lustige Zeit, in der ich mit meiner Austauschschülerin und Freunden Filme geguckt, im Auto zu Musik gesungen und über alles und nichts geredet habe.
Auch Alkohol und Drogen scheinen eine Rolle in dem amerikanischen Jugendleben zu spielen, obwohl ich davon nur erzählt bekommen habe. Bei mir wurde der Eindruck erweckt, dass es zwar viele junge Menschen gibt, die sich ausprobieren möchten, vor allem im Rauchen von E-Zigaretten, aber auf der anderen Seite auch genauso viele, die sich davon fernhalten, was auch damit zu tun haben könnte, dass der Konsum von Alkohol in Amerika erst ab 21 erlaubt ist und, dass die Eltern häufig strenger sind. Damit geht einher, dass es keine Möglichkeit gibt, für Jugendliche in Clubs feiern zu gehen und auch der Alkohol- und Drogenkonsum, der bei vielen gerade aufgrund des strikten Verbots einen besonderen Reiz zu haben scheint, birgt selbstverständlich ein höheres Risiko.
Für mich war es sehr seltsam festzustellen, wie streng Alkohol verboten ist und wie schnell man dafür Auto fahren darf, was in Deutschland fast umgekehrt zu sein scheint. Beides vermittelt einem jungen Menschen meiner Meinung nach das Gefühl, ein Stück weit mehr Teil der Gesellschaft und vor allem erwachsener zu sein und es ist krass, wie sehr sich die Sichtweisen von zwei Staaten auf diese zwei Aspekte unterscheiden können. Während es für einen deutschen Jugendlichen unvorstellbar ist, schon mit 16 alleine mit dem Auto durch die Straßen seiner Stadt zu fahren, denkt der amerikanische Jugendliche das gleiche über das Kaufen von Bier mit dem Ausweis eines Sechzehnjährigen.
Und doch ähneln sie sich und leben das Leben eines normalen jungen Menschen und gehen zur Schule, machen Sport, essen Frozen Joghurt, gehen ins Kino oder in Restaurants und backen Kekse.
Das Familienleben und der Konsum
Essen gegangen bin ich mit meiner Gastfamilie auch sehr häufig, was für mich etwas neues war, denn hier in Deutschland macht meine Familie das äußerst selten, wohingegen das gemeinsame Essen in Restaurants auch unter der Woche Teil des Familienlebens für meine Gastfamilie ist. Offen gesagt, kam mir das Auto manchmal, nicht nur bezogen auf diesen Aspekt, wie die Erweiterung des Wohnzimmers vor. Das meine ich aber definitiv positiv, denn mir hat es wirklich gut gefallen, wie die Familie sich Zeit füreinander genommen und auch mich als Austauschschülerin mit einbezogen hat.
Das Essen an sich unterscheidet sich ebenfalls von dem deutschen, denn ich konnte feststellen, dass es das Vorurteil des ungesünderen Essens nicht so ganz ohne Grund gibt. Zwar wurde in meiner Gastfamilie gerne und viel gekocht, auch gesund, allerdings gab es immer Snacks für zwischendurch. Eine der Küchenablagen war immer überfüllt mit Chips, Popcorn und Süßigkeiten und es wurde sich auch reichlich bedient. Außerdem waren Burger und Pizzen keine Seltenheit zum Abendessen. Ich möchte den Amerikanern zwar nichts unterstellen, aber ich habe das Gefühl, dass generell mehr gegessen wird. Ein guter Indikator dafür sind zum Beispiel die zwei riesigen Kühlschränke und die zwei Gefriertruhen, die meine Gastfamilie hat, obwohl ich auch denke, dass dafür seltener eingekauft wird, als in Deutschland, da man einfach mehr Aufbewahrungsmöglichkeiten hat.
Zu dem Essen kann ich insgesamt sagen, dass ich es sehr lecker finde und es genossen habe, es aber definitiv nicht vermisse. Mir kam alles extra riesig vor, sei es ein Getränk bei Starbucks, ein Burger oder ein Frozen Joghurt.
Außerdem kam mir das Kaufverhalten, vor allem im Hinblick auf das Essen, ziemlich bedenkenlos und die Maschinerie einer riesigen Konsumgesellschaft unterstützend, gefördert durch gigantische Grocery Stores und Drive Thrus, vor. Das ist in Deutschland auch nicht viel besser, aber ein beträchtlicher Unterschied ist definitiv der Verbrauch von Plastiktüten. Ich habe schon davon gehört, dass man beim Einkaufen in Amerika sehr viele Tüten aus Plastik nutzt, allerdings wurde mir das Ausmaß dessen erst richtig bewusst, als ich das erste Mal mit meiner Gastmutter in einem Grocery Store, einem gigantischen Supermarkt, einkaufen war und es an der Kasse eine Angestellte gab, die ausschließlich dafür zuständig war gefühlt jedes einzelne Produkt in eine kleine und dünne Plastiktüte einzupacken. Meiner Meinung nach wäre es so einfach, sich ein paar Jutebeutel zum Einkaufen anzuschaffen, doch mir scheint das Bewusstsein dafür einfach viel zu klein zu sein. Laut dem Tagesspiegel liegt der jährliche Verbrauch von Plastiktüten in Amerika bei ungefähr 100 Milliarden, eine immense Zahl, die sogar noch größer wirkt, wenn man bedenkt, wie viel weniger Einwohner das Land verglichen dazu hat. Aktuell sind es ungefähr 327,2 Millionen.
Mein Fazit zu dem Austausch
Mir ist zwar sehr deutlich geworden, dass die Gesellschaft an einigen Stellen vom Konsum geleitet wird und das Umweltbewusstsein gering ist, aber, dass es, wie eigentlich überall auf der Welt, kein Böse und Gut, kein Schwarz und Weiß gibt. Es gibt genauso viele positive Gesichtspunkte in der Gesellschaft, die das Land gemeinsam mit dem Negativen einzigartig machen.
Was mir beispielsweise besonders gut gefällt, ist die Gastfreundschaft, mit der ich aufgenommen wurde. Sehr gerne blicke ich auf die Zeit mit meiner Gastfamilie und in der Schule zurück, die eine unvergessliche war. Auch wenn die Menschen zum Teil oberflächlich wirken und es auch sein können, sind sie sehr herzlich und offen und wenn man jemanden besser kennenlernt, wird diese Ebene abgelöst. Auch mit Amerikanern kann man ehrliche und offene Gespräche führen und auch sie schauen kritisch auf ihre Gesellschaft.
Ich habe die Zeit mit meiner Gastfamilie immer sehr genossen, denn sie haben mich wirklich in ihre Familie aufgenommen und haben mich nicht nur in Restaurants oder ins Kino mitgenommen, sondern auch am ganz alltäglichen Leben, wie einkaufen oder in die Kirche zu gehen, teilhaben lassen. Ich habe schnell gemerkt, dass sie sich wirklich für meine Kultur interessieren; oft haben wir uns über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Amerika und Deutschland unterhalten und immer, wenn ich nach der Schule erzählt habe, wie der Tag gewesen ist oder, wenn ich mit meiner Gast-Oma Karten gespielt habe, hatte ich das Gefühl, ein Teil der Familie zu sein. Natürlich hatte ich bessere und schlechtere Tage, aber um Heimweh zu haben, hatte ich gar keine Zeit bei all den neuen Eindrücken und Erfahrungen.
Ein anderer Aspekt, den man in Deutschland nicht so schnell findet, ist der starke Zusammenhalt, den ich in dieser offensichtlichen Form zum ersten Mal bei einem amerikanischen High-School-Basketballspiel erlebt habe.
Auch generell ist der Besuch einer High School eine für mich wertvolle Erfahrung, denn die vielen Unterschiede haben mir gezeigt, wie sehr Bildung vom Gesetzgeber abhängt und wie unterschiedlich dieser Begriff aufgegriffen und interpretiert werden kann. Diese Erkenntnis hat mir auch gezeigt, wie sehr ich die eigenständige Erarbeitung von Unterrichtsinhalten, die in Deutschland vor allem durch Unterrichtsdiskussionen erfolgt, wertschätzen kann. Diese Form des Lernens hat mir in Amerika meistens gefehlt, obwohl sie meiner Meinung nach essentiell für die Bildung ist.
Insgesamt kann ich sagen, dass die Erfahrung mich gelehrt hat, nicht alles so einfach hinzunehmen, sondern aus einem anderen Blickwinkel auf gesellschaftliche Themen zu schauen, auch hier in Deutschland, mir aber auch darüber bewusst zu sein, dass ich Gast in einem anderen Land bin und keine voreingenommenen Urteile zu fällen, sondern mich auf die Kultur einzulassen und wertzuschätzen, was das Land mit den darin lebenden Menschen, seiner Kultur, seiner Geschichte und dem Klima zu bieten hat. Damit meine ich nicht, dass man sich als Gast in einem anderen Land keine Meinung über bestimmte Aspekte bilden sollte, man sollte nur nicht schon mit der Einstellung ankommen, dass im eigenen Land sowieso alles besser ist. Stattdessen sollte man sich einfach auf das Gastland einlassen. In diesem Text bin ich zwar an mehreren Stellen auf bestehende Vorurteile gegen Amerikaner eingegangen, jedoch ausschließlich aus dem Grund, dass es für mich persönlich interessant war, herauszufinden, wie viel sie wirklich aussagen. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass man natürlich immer jemanden finden wird, der in ein bestimmtes Vorurteil passt, sozusagen in das Bild eines stereotypisierten Amerikaners, dass man aber auch immer jemanden finden wird, der nicht in diese Schublade passt. Letztendlich sprechen die meisten Vorurteile, wie das des ungesunden Essens oder der Oberflächlichkeit, gesellschaftliche Themen an, die sich von denen unseres Landes unterscheiden, die allerdings keineswegs auf jede in dieser Gesellschaft lebende Person zutreffen. So ist es ja im Endeffekt immer mit Vorurteilen: Wenn man will, findet man schnell Beweise dafür, dass sie wahr sind.
Doch der Austausch hat mir nicht nur geholfen, charakterlich zu wachsen, sprich offen und gespannt auf neue Menschen und neue Kulturen zuzugehen, dankbar für all das zu sein, was ich erleben darf und ein wenig selbstständiger durch die Welt zu laufen. Auch im Sprachlichen habe ich eine ungemeine Entwicklung gemacht, denn auf einen Austausch zu fahren und gezwungen zu sein, in einer anderen Sprache zu kommunizieren, macht es unmöglich, sie nicht besser zu lernen. Nicht nur mein Ausdrucksvermögen hat sich stark erweitert, ich kann jetzt auch sprechen, ohne vorher darüber nachzudenken und bin im Englischen viel spontaner. Man erlangt automatisch Kenntnisse, die man im Unterricht nicht so leicht erwerben könnte und der Spaß am Lernen der Sprache wächst mit den Tagen, an denen man ihr ausgeliefert ist.
Meiner Meinung nach lohnt es sich auf alle Fälle, an einem Austausch teilzunehmen. Dieser hat mir insbesondere gut gefallen, weil ich schon immer gerne nach Amerika reisen wollte und ich so die Möglichkeit hatte, sogar acht Wochen lang in die Kultur einzutauchen und am Schulleben teilnehmen zu können, ohne die Schule in Deutschland zu vernachlässigen. Außerdem findet das Programm in beide Richtungen statt, weshalb meine Austauschschülerin im Sommer drei Wochen bei mir verbracht hat.
Der Austausch hat definitiv Spaß gemacht und ich würde ihn jedem weiterempfehlen, der Lust hat seine Englischkenntnisse zu erweitern, neue Leute kennenzulernen und mal so ganz aus dem eigenen Alltag gerissen zu werden.
Anmerkung: Damit der Text angenehmer und leichter zu lesen ist, habe ich an vielen Stellen nur die männliche Form genutzt. Das hat wirklich keinen anderen Grund und die Form steht natürlich stellvertretend für beide Geschlechter.
Jedes Schuljahr haben vier bis fünf Schülerinnen und Schüler des zehnten Jahrgangs unserer Schule die Möglichkeit, zwei Monate lang das Schulleben unserer Partnerschule in Amerika, der „Goshen High School“, zu erleben und bei einer Gastfamilie zu wohnen. Goshen ist eine kleine Stadt im Bundesstaat Indiana und befindet sich unter anderem in der Nähe von Chicago. Organisiert wird dieser Austausch von Herrn Fischer und Herrn Balkenohl, die eng mit Deutschlehrern von der amerikanischen Schule zusammenarbeiten.
Ich bin eine von den fünf Schülerinnen, die letztes Jahr, 2019, an dem Austausch teilgenommen haben. Dieser Artikel handelt von meinen Eindrücken und Erfahrungen, die ich auf der einen Seite in der Schule, und auf der anderen im alltäglichen Leben sowie auf Ausflügen mit meiner Gastfamilie, gesammelt habe. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass ich aus meiner ganz persönlichen Sichtweise schreibe und “nur” in einer Stadt und somit auch in einem Staat von Amerika gelebt habe und zur Schule gegangen bin. Dieser Text ist also keineswegs zu verallgemeinern und auf ganz Amerika zu beziehen. 🙂
Bevor ich den Austausch gemacht habe, hatte ich so gut wie keine Vorstellung von Amerika, da meine einzigen Informationsquellen einzelne High-School-Filme und Bücher waren.
Trotzdem war für mich ziemlich schnell klar, dass ich mich für den Austausch bewerben möchte, einerseits aufgrund der Möglichkeit, mein Englisch verbessern zu können und andererseits weil Amerika, auch wenn ich nie ein wirklich genaues Bild vor Augen hatte, mich schon immer gereizt hat und ich wusste, dass ich das Land sehr gerne mit eigenen Augen sehen würde. Vielleicht lag der Reiz auch gerade darin, dass ich einzelne Bilder im Kopf hatte und vor Ort sehen wollte, wie sich alles zu einem großen Ganzen zusammenfügt.
Das Schulsystem
Auch von dem amerikanischen Schulsystem wusste ich nichts, wenn man von Klischees über Cheerleader, Football-Spieler und Musicals absieht. Jetzt kann ich sagen, dass sich die „Goshen High School”, die mit ihren circa 1.945 Schülerinnen und Schülern mehr als doppelt so groß ist wie das MPG, in vielen Aspekten von unserer Schule unterscheidet. Angefangen damit, dass die Schülerinnen und Schüler erst eine Grundschule, anschließend eine “Middle School” und schlussendlich von der neunten bis zur zwölften Klasse eine High School besuchen. Es gibt sogar besondere Bezeichnungen für die einzelnen Jahrgangsstufen, losgehend bei Freshman, woraufhin man erst zum Sophmore, dann zum Junior und als letztes zum Senior wird. Auf mich wirkte die Grundstimmung in der Schule von Anfang an ganz anders, da keine unterschiedlichen Altersgruppen und sich in ganz verschiedenen Entwicklungen befindenden Personen aufeinandertreffen konnten, was irgendwie zu einem reiferen Eindruck führte, obwohl das in der Praxis auch nicht immer stimmte.
Ein weiterer elementarer Punkt ist, dass man keinen Unterricht im Klassenverband, beziehungsweise keine Stammkurse wie in der zehnten Klasse bei uns, hat. Jeder Schüler bekommt seinen Individuellen Stundenplan, den er ähnlich wie bei uns, aus Pflicht- und Wahlfächern zusammenstellen kann.
Allerdings gibt es eine “Lernstunde” als festes Unterrichtsfach, in der man Hausaufgaben und Projekte erledigen soll. Für gewöhnlich hat man diesen Unterricht in den vier Jahren an der High School durchgehend mit den gleichen Mitschülern und dem gleichen Lehrer. Diese Lehrkraft ist für die Schüler in seiner Gruppe der Ansprechpartner, “guidance counselor” genannt, und begleitet sie bis zum Schulabschluss. So entstehen doch Gemeinschaften, denen man sich zugehörig fühlen kann und man hat immer die Möglichkeit für individuelle Beratung, auch im Hinblick auf die Pläne nach der Schule. Dieses Konzept sagt mir zu, denn so hat man viele Freiheiten bezogen auf den Stundenplan, es ist aber trotzdem immer jemand da, der die Schüler im Einzelnen unterstützt und es ist gesichert, dass die Hausaufgaben gemacht werden, da man sich in der Unterrichtsstunde gezwungenermaßen damit beschäftigen muss.
Wir Austauschschülerinnen wurden zudem individuell von zwei Deutschlehrern der Schule begleitet, an die wir uns immer wenden konnten und die ein spezielles Programm für uns vorbereitet hatten, in dem wir mehr über die amerikanische Kultur lernen, und uns über die Erlebnisse in unseren Gastfamilien austauschen konnten.
Ein anderer grundlegender Unterschied ist die Stundenplanung: Am Montag hat man jedes Fach, das man belegt hat, für jeweils 47 Minuten. An den anderen vier Tagen findet abwechselnd jeweils eine Hälfte der gewählten Fächer statt, wobei diese länger als montags unterrichtet werden, was dazu führt, dass an allen Tagen fast zur gleichen Zeit, um 15.40 Uhr Schulschluss ist. Zudem sind die Pausen anders gelegt: Während wir zwei Pausen à 20 Minuten und eine lange Mittagspause haben, gibt es dort nach jeder Stunde eine fünf- bis siebenminütige Pause, abhängig vom Tag, und eine Mittagspause, die eine halbe Stunde lang ist. Diese Mittagspause findet in einer Unterrichtsstunde statt. Die betroffene Stunde ist 30 Minuten länger als sonst, und je nachdem, ob man A, B, C oder D-Lunch hat, geht man am Anfang, am Ende oder mitten in der Stunde in die Cafeteria, wo Essen gekauft werden kann. Das schmeckt leider den meisten nicht wirklich gut, weshalb viele Schüler Lunch-Pakete von zu Hause mitbringen. Am Anfang ist es definitiv eine Umstellung, den Unterricht zu unterbrechen, um essen zu gehen, und ihn danach fortzuführen, aber ich habe mich schnell daran gewöhnt. Vor allem, wenn ich das Thema interessant fand, konnte ich mich schon während des Essens darauf freuen, weiterzuarbeiten.
Auch das Fächerangebot ist anders und viel breiter aufgefächert als an unserer Schule, was vermutlich auch mit der Größe der beiden Schulen zu tun hat. Das Fach Mathe beispielsweise ist in unterschiedliche Kurse aufgeteilt, darunter befinden sich Algebra und Geometrie. Ähnlich ist das auch bei dem Fach Kunst: Keramik und Zeichnen sind zwei der künstlerischen Fächer. Außerdem gibt es Schulfächer, die bei uns gar nicht angeboten werden, wie zum Beispiel Wirtschaft, “Leben als ein Erwachsener” oder die Mitarbeit an dem eigenen Fernsehsender der Schule, der innerhalb einer bestimmten Saison täglich über Neuigkeiten aus der Schule berichtet. Trotzdem ist die Wahl selbstverständlich nicht komplett einem selbst überlassen. So ist es zum Beispiel wichtig, dass man sich früh Gedanken darüber macht, was man später an einem College studieren möchte. Hierfür muss man teilweise schon an der High School relevante Kurse belegen.
Die Vielfalt der Fächer hat mir definitiv gut getan und ich habe es genossen im Keramik-Unterricht zu töpfern oder in “US Government” alles Wichtige über die amerikanische Regierung zu lernen. Auch das Orchester und andere Musikensembles können als Unterrichtsfach belegt werden - meiner Meinung nach ein gutes Konzept, da man die Möglichkeit hat, ein Instrument zu erlernen und dieses Hobby in seine Bewertung einfließen zu lassen.
Einige Fächer finden zudem jahrgangsstufenübergreifend statt, was dazu geführt hat, dass ich als Zehntklässlerin auch Unterricht mit Elft- und Zwölftklässlern hatte.
Der Unterricht an sich sieht ebenfalls anders aus: Ein wichtiger Punkt ist, dass jeder Schüler einen Laptop von der Schule bekommt, der auch mit nach Hause genommen wird. Darauf können Hausaufgaben gemacht werden und anschließend direkt elektronisch bei dem Lehrer eingereicht werden. Auch im Unterricht wird viel damit gearbeitet, und sogar Tests und Klassenarbeiten werden oft darauf geschrieben. Diese Prüfungen sind meiner Meinung nach einfacher als die an unserer Schule und sie dauern außerdem nicht so lang. Sie bestehen meist sowohl aus Multiple-Choice- als auch aus Schreibaufgaben, wobei Erstere definitiv überwiegen. Und wenn man eine Prüfung nicht bestanden hat oder nicht zufrieden mit der Note ist, kann man sie wiederholen, soviel ich mitbekommen habe, so oft man möchte. Nach Prüfungen oder bei abgegebenen Hausaufgaben, trägt der Lehrer die Note direkt in ein Online-System ein, das sofort eine aktuelle Note aus allen bisherigen Teilleistungen bildet. So hat jeder Schüler zu jeder Zeit Zugang zu seinen Noten und kann nachvollziehen, wie diese sich zusammensetzen. Meist wissen die Lehrer gar nicht, welche Note der Schüler aktuell hat, denn mündliche Mitarbeit wird nicht bewertet. Es gibt zwar neben Prüfungen und Hausaufgaben eine Kategorie in der Bewertung, die “Unterrichtsmitarbeit” heißt, damit ist allerdings gemeint, ob man gut auf die Stunde vorbereitet ist, mitarbeitet und nicht negativ auffällt. Ich persönlich finde es besser, wenn auch die mündliche Mitarbeit bewertet wird, denn das zwingt den Schüler zum Mitdenken und dazu, sich mit dem Unterrichtsthema auseinanderzusetzen. Vor allem haben mir anregende Unterrichtsdiskussionen gefehlt und es schien mir manchmal, dass einige Schüler ganz vergessen hatten, dass sie sich gerade in der Schule befanden. Das kann bei uns natürlich auch passieren, es ist hier aber viel schwieriger, sich den Erwartungen des Lehrers zu entziehen. Die meisten amerikanischen Lehrer haben zwar versucht, ihre Schüler mit in den Unterricht einzubeziehen, sind aber oft gescheitert oder mussten ihre Frage mehrmals wiederholen, bis jemand darauf geantwortet hat. Mir wurde ziemlich schnell klar, dass man sich im Unterricht also keine Sekunde lang konzentrieren muss und trotzdem ein A, die beste Note, bekommen kann, solange man alle Aufgaben pünktlich einreicht, die mit Hilfe des Internets auch nicht allzu viel Zeit in Anspruch nehmen sollten, und für die Prüfungen lernt.
An dieser Stelle hat mir wirklich etwas gefehlt, da ich nicht das Gefühl hatte, durch diese Methode wirklich gut lernen und den Unterrichtsstoff aufnehmen zu können, der mir zusätzlich auch noch sehr viel weniger anspruchsvoll erschien.
Neben der mündlichen Mitarbeit hat mir vor allem die Ebene der eigenen Interpretation und Bewertung gefehlt, da die persönliche Meinung zu bestimmten Themen zwar angegeben werden konnte, ich aber nie mitbekommen habe, dass diese wirklich erklärt werden sollte. Meiner Meinung nach ist gerade die Fähigkeit der eigenen Meinungsbildung und die damit verbundene immer größer werdende Selbstständigkeit eine der wichtigsten Kompetenzen, die eine Schule an ihre Schüler vermitteln sollte.
Was mir am Unterricht allerdings besonders gefallen hat, ist, dass die Lehrer oft vorbereitete Kopien austeilen, die schon einige Schlagwörter aufzeigen und die Struktur der Notizen vorgeben, die der Schüler aber im Endeffekt selbst ausfüllen muss. Ich denke, dass das den Schüler auf der einen Seite zum aktiven Mitschreiben bringt, und andererseits sowohl dem Schüler als auch dem Lehrer die Sicherheit gibt, dass der Schüler auch das wirklich wichtige und für Prüfungen relevante notiert hat.
Und auch die Unterrichtsstunden bestehen nicht nur aus einseitigem Frontalunterricht, es wird zum Beispiel in Gruppen an Projekten gearbeitet oder an den Laptops recherchiert beziehungsweise gelernt. Im Spanischunterricht wurde zum Beispiel viel mit Onlinespielen zum Lernen von Vokabeln oder Grammatik gearbeitet, die unsere Lehrerin selbst erstellt hatte. Und am Anfang jeder “US Government”-Stunde hat die Klasse gemeinsam die Nachrichten geschaut.
Eine andere interessante Charaktereigenschaft der amerikanischen Schule, die ich beobachtet habe, ist das sehr viel gelassenere Verhältnis von Lehrern zu Schülern. Während bei uns zumeist eine gewisse Distanz zwischen Schüler und Lehrer herrscht, begrüßen sich an der High School Schüler und Lehrer auf dem Flur mit einer Bro Fist oder machen Witze übereinander, wobei es in beiden Ländern selbstverständlich von Person zu Person anders aussieht.
Ein weiterer wichtiger Unterschied ist, dass man das Schulgelände nicht verlassen darf. Es gibt eine Tür, zu der morgens jeder reinkommen muss, und dort wird kontrolliert, ob alle Schüler eine ID um den Hals tragen. Diese ID ist zu vergleichen mit unseren Schülerausweisen, mit dem einzigen Unterschied, dass man sie immer bei sich haben und an einem Band sichtbar um den Hals tragen muss. Auch in der Mittagspause muss man sich in der Cafeteria oder im Forum aufhalten, sogar das Betreten der Schulflure ist dann verboten. Und selbst wenn man den Klassenraum während des Unterrichts verlässt, um beispielsweise auf die Toilette zu gehen, muss der Lehrer einen unterschriebenen “Flur-Pass” ausstellen.
Dies alles soll selbstverständlich die Sicherheit an der Schule erhöhen. Doch ich muss sagen, dass ich mich manchmal sehr stark kontrolliert gefühlt habe.
An einem Tag waren sogar Polizisten in der Schule stationiert, da Amoklaufgefahr aufgrund einer anonymen Botschaft auf einer Toilettenwand bestand, die sich später aber als ein blöder Scherz herausstellte. Ich muss sagen, dass ich den ganzen Tag über ein mulmiges Gefühl im Magen hatte und unsicher war, ob es eine gute Idee gewesen war, zur Schule zu gehen.
Für die Mitschüler und Lehrer, mit denen ich mich darüber unterhalten habe, war das Phänomen einer solchen Drohung nicht ungewöhnlich, was auf mich erschreckend, aber trotzdem irgendwie auch beruhigend wirkte. Dieses Erlebnis hat mir vor Augen geführt, wie glücklich ich mich schätzen kann, in einem Land zu leben, in dem es nur nötig ist, in Schulen das Verhalten im Fall von Feueralarm zu üben und nicht bezogen auf einen Amoklauf.
Solche großen politischen Unterschiede können sich ganz unabhängig von der Lebensweise einer Person sehr stark auf ihr Leben auswirken.
Ein anderer wirklich grundlegender Kontrast zu Deutschland ist, dass es in Indiana schon mit 16 Jahren möglich ist, den Führerschein zu machen, weshalb viele Schüler mit dem Auto zur Schule kommen. Das kann man als typisch für Amerika bezeichnen. Für Schüler, die mehr als eine Meile, was ungefähr anderthalb Kilometer sind, von der Schule entfernt wohnen, gibt es aber auch die Möglichkeit, mit Schulbussen zu fahren, die ebenfalls in ihrem typischem Gelb durch die Straßen fahren.
Da High Schools normalerweise Ganztagsschulen sind, gibt es ein breit gefächertes Angebot an Arbeitsgemeinschaften, sogenannten Clubs. Wir deutschen Austauschschülerinnen waren zu einem Treffen des German Club eingeladen, wo Deutschschüler über unsere Kultur lernen und sich austauschen, um ein Beispiel zu nennen.
Ein ebenfalls sehr beliebtes Angebot der Schule sind die verschiedenen Sportteams, die von Wrestling über Basketball bis hin zu Cheerleading reichen. Wer Mitglied in einem der Teams ist, muss den normalen Sportunterricht der Schule nicht besuchen, hat dafür aber mehrmals in der Woche ein intensives Training. Meine Austauschschülerin spielt zum Beispiel Tennis und musste auch außerhalb der Saison zum Stabilisationstraining. Der Sport macht ohne Zweifel einen großen Teil der High School aus und sie scheint sich in gewissem Maße durch die Stärke ihrer Teams zu definieren.
Die Mentalität an der Schule
Um von der akademischen und organisatorischen Seite der Schule zur dort vorherrschenden Mentalität und dem zwischenmenschlichen Aspekt überzugehen, sind die Basketballspiele die perfekte Brücke.
Die großen Sportevents sind vermutlich etwas, womit fast jeder eine amerikanische High School verbindet. Und das auch zu Recht: Ich habe drei Basketballspiele miterlebt, die wirklich überwältigend waren. Sehr viele Schüler, Lehrer und Eltern sind gekommen, um das Team anzufeuern und zu unterstützen. Jede dieser Gruppen hat seine eigene Zuschauertribüne in der Sporthalle und in jedem einzelnen Teil war die Stimmung sehr intensiv. Sprechgesänge waren keine Ausnahme und, egal, ob das Team am gewinnen war oder zurücklag, ich habe immer ein starkes Gemeinschaftsgefühl zwischen den Zuschauern untereinander, aber auch mit dem Team wahrgenommen. Das begann schon bei der “Pledge of Allegiance”, dem Treuegelöbnis für die Nation vor der amerikanischen Flagge. Der Fanblock des gegnerischen Teams wurde zum verfeindeten Lager und die gesamte Konzentration des Raumes schien sich in der Mitte, auf dem Spielfeld, zu ballen. Die Spiele konnten so spannend werden, dass ich so sehr mitgefiebert habe, wie ich es vorher noch nie erlebt habe. Die Wut, die Erleichterung, die Freude, begleiteten mich oft bis in den Abend. Die Cheerleader, die den Anschein hatten einem High-School-Film entsprungen zu sein, haben die Emotionen und das Gefühl der Zugehörigkeit in ihren Auftritten vor, während und nach dem Spiel, noch verstärkt. Als Komplettierung des Spektakels diente zudem die Marching Band der Schule, ein riesiges Blasorchester mit Percussionbegleitung.
Der eigentliche Schulalltag steht in Teilen allerdings im Gegensatz zu dem Zusammengehörigkeitsgefühl während der sportlichen Ereignisse. So habe ich mitbekommen, dass es eine starke Gruppenbildung gibt. Zwischen diesen Gruppen gibt es allem Anschein nach wenig Austausch, was wahrscheinlich auch dem Kurssystem geschuldet ist, dass es nicht wirklich erlaubt, sich mit jemandem außerhalb des Freundeskreises intensiver zu beschäftigen. Trotzdem wirkte der Umgangston meist freundlich, aber oft auch oberflächlicher als bei uns.
An mir als Austauschschülerin waren einige Schülerinnen und Schüler sehr interessiert und wollten etwas über mich und über Deutschland erfahren. Dabei habe ich festgestellt, dass es viele amerikanische Jugendliche gibt, die kein anderes Land als ihres kennen. Einige sind in einem wirklich nur sehr geringen Maße über den Rest der Welt aufgeklärt, was mich manchmal zum Stutzen gebracht hat. Ich denke, dass das aber auch viel mit der Größe von Amerika zu tun hat.
Ich habe zwar im Unterricht schnell Menschen finden können, mit denen ich mich unterhalten und zusammen arbeiten sowie mittagessen konnte, ich denke aber, dass es auf Dauer schwieriger für mich geworden wäre als in Deutschland wirkliche Freundschaften zu knüpfen, da wie ich es empfunden habe, eine gewisse Oberflächlichkeit zwischen den Menschen besteht, die erst mit der Zeit überwunden werden kann.
Die dadurch entstehende allgegenwärtige Freundlichkeit führt dazu, dass sich die Schüler und Schülerinnen untereinander sehr viel mehr Komplimente geben, die sich allerdings oft eher unpersönlich auf das äußere Erscheinungsbild der Person beziehen, und auch die Frage “How are you doing?” ist vielmehr als eine nette Begrüßung zu verstehen, die keine ehrliche Antwort erwartet und erwünscht.
Ich denke, dass die wirkliche Persönlichkeit eines Menschen in der amerikanischen Schule und Kultur erst später zum Vorschein kommt, dafür aber viel mehr Herzlichkeit zu finden ist.
Fazit zum Schulleben
Abschließend kann ich sagen, dass die Schule an vielen Stellen so ist, wie ich mir eine amerikanische Schule vorgestellt hatte und wie sie auch in Filmen dargestellt wird. Dazu gehören beispielsweise die oben beschriebenen Basketballspiele mit Cheerleadern und ganz simpel auch das Gebäude mit all den großen Fluren, Sporthallen und Schließfächern. Was ich allerdings nicht erwartet hätte ist, dass der Unterricht gemessen an unserem sehr viel weniger anspruchsvoll ist. Dafür hat er mir aber fast immer Spaß gemacht und wenn es um die Digitalisierung geht, liegt die High School auf jeden Fall vorne.
Was meine zwischenmenschlichen Erfahrungen angeht, kann ich noch einmal herausheben, dass das Klima zwar ein wenig lockerer war, es aber wie auch hier in Deutschland immer von den Personen abhängt, die dich umgeben, was jetzt zwar wahrscheinlich banal klingt, aber ich denke, dass es wichtig ist das an dieser Stelle herauszustellen, um zu betonen, dass Generalisierungen verbunden mit Vorurteilen in keiner Situation weiterhelfen, sondern ganz im Gegenteil nur behindern. Es ist wichtig, sich auf die Kultur und die Menschen einzulassen, wenn man etwas über sie lernen möchte und man sollte nicht vergessen, dass man der Gast ist und keineswegs den Anspruch haben sollte, dass die Menschen die eigenen Erwartungen erfüllen. Es gab sehr viele Schüler, die wirklich nett waren und mit denen man sich gut unterhalten konnte, auf der anderen Seite gab es aber auch unsympathische. Was das Vorurteil angeht, dass Amerikaner oberflächlicher sind, kann ich sagen, dass es vordergründig zu großen Teilen stimmt, dass eine Freundlichkeit auf Small Talk Basis vorhanden ist, die aber auch nicht auf jeden zutrifft und definitiv nicht das innere der Menschen widerspiegelt, was man feststellen kann, wenn man sie besser kennenlernt.
Als Bildungsinstitution leistet die Schule meiner Meinung nach nicht so viel wie zum Beispiel unsere, was auch von einigen Amerikanern so gesehen wird. Ein Lehrer, mit dem ich mich darüber unterhalten habe, meint, dass man durch den starken sportlichen Aspekt den akademischen schnell aus den Augen verliert, was auch meine Gastmutter, die ebenfalls Lehrerin ist, so sieht. Dafür war die Stimmung einfach lockerer und ich denke, dass deutlich weniger Druck vorhanden ist.
Für mich war der Besuch einer High School definitiv eine gewinnbringende Erfahrung, die mir geholfen hat, mein Wissen zu vergrößern und etwas einzigartiges zu erleben und für zwei Monate eine High-School-Schülerin zu werden, die den Geist dieser Schule fühlt und lebt.
Ausflüge mit meiner Gastfamilie – Highlights beim Besichtigen
Ich hatte das Glück eine sehr nette und offene Gastfamilie bekommen zu haben, die mich herzlich aufgenommen und viel mit mir unternommen hat. Meine Austauschschülerin ist ein Jahr älter als ich und war somit ein Junior (elfte Klasse) während ich ein Sophmore (zehnte Klasse) war. Wir haben uns gut verstanden und viel zusammen unternommen. Auch ihre Eltern und ihre Großmutter, die im gleichen Haus lebt, haben mich nicht nur in das Familienleben mit einbezogen, sondern ebenfalls auf spannende und interessante Ausflüge mitgenommen.
Mein erster großer Ausflug ging nach Indianapolis, die Hauptstadt von Indiana, wo ich das College, an dem eine meiner Gastschwestern studiert, gezeigt bekommen habe. Sie lebt in einem Studentenwohnheim auf dem Campus ihres Colleges und durch eine Führung von ihr habe ich einen guten Einblick bekommen in die einzelnen Gebäudekomplexe, aus Unterrichtsgebäuden, der Kantine, Kiosken, Wohnheimen, Sportplätzen und vielem mehr. Ich habe richtig Lust bekommen, dort zu studieren, denn ich glaube, dass man sich als Student an einem College irgendwie als Teil einer riesigen Familie fühlt. Man wohnt zusammen, lernt zusammen, macht zusammen Sport und hat Spaß. Das Gemeinschaftsgefühl aus der High School muss sich dadurch bestimmt noch verstärken.
Neben dem College haben wir noch viele weitere Punkte in Indianapolis besichtigt, darunter das “Indianapolis Museum of Art”, das eine schöne und interessante Mischung aus moderner und älterer Kunst bietet, einen Aussichtsturm und ein großes Einkaufszentrum. Für mich persönlich war der Höhepunkt aber eindeutig eine Kutschfahrt durch die Innenstadt. Die riesigen Gebäude um mich herum haben mir ein ganz neues Gefühl gegeben, mir vor Augen geführt, wie weit weg ich von zu Hause bin und wie sehr man in der Ästhetik einer Stadt mit all ihren Lichtern versinken kann.
Einen anderen unvergesslichen Tag haben wir in der Millionenstadt Chicago im Bundesstaat Illinois verbracht. Der Bekanntheitsgrad dieser Stadt hat es für mich natürlich noch aufregender und interessanter gemacht, vor allem, weil ich im Gegensatz zu den anderen Orten, schon vorher etwas von ihr gehört und ein ungefähres Bild vor Augen hatte. Nichtsdestotrotz wusste ich nicht, was für eine Größe, die eine andere Dimension zu haben scheint als der Rest der Welt, mich erwarten würde. Meine Eindrücke aus Indianapolis wurden hier noch übertroffen: Als ich aus dem Auto stieg, hatte ich regelrecht den Eindruck, mich in einem Wald aus gigantischen Bauwerken zu befinden, der an vereinzelten Stellen durch große Plätze, Lichtungen, geöffnet wurde. Die Stadt kam mir vor wie ein weit verzweigtes, riesiges Netzwerk aus Wolkenkratzern bis zum Horizont. Noch verstärkt wurde dieser Eindruck durch den Besuch des “Skydecks”, der 103. Etage des Willis Towers, der mit seinen 527,3 Metern das höchste Bauwerk Chicagos ist und sogar den zwanzigsten Platz in der gesamten Welt hat. Der Blick aus einer Glaskapsel heraus, die einem das Gefühl gibt, keinen Boden unter den Füßen zu haben, ist unbeschreiblich. Vor meinen Augen breitete sich ein Netz aus Gebäuden und Straßen aus, das größer nicht hätte sein können, abgerundet durch das sich weit erstreckende Blau des Lake Michigan.
Auch eine Chicago-Style Pizza darf man sich nicht entgehen lassen: Mit ihrer Höhe gleicht sie vielmehr einer Lasagne, als einer Pizza. In dieser Hinsicht bestätigt sich ein in Deutschland verbreitetes Bild über die amerikanische Esskultur, wobei ich sagen muss, dass das ein typisches Gericht unter vielen ist und dazu auch noch sehr lecker.
Insgesamt kann ich sagen, dass ich den Ausflug nach Chicago so schnell nicht vergessen werde. Zu den geschilderten Eindrücken kam auch noch ein Filmabend in einem IMAX Kino hinzu, welches das Schauen von “Captain Marvel” auf seiner riesigen Leinwand zu einem ganz besonderen Erlebnis gemacht hat, und ein abendlicher Spaziergang inmitten eines starken Regenschauers, der mir vor Augen geführt hat, dass Regen auch schön sein kann.
Ein letzter für mich besonderer Trip ging nach Shipshewana, eine Stadt, die einen wirklich krassen Kontrast zu Chicago und Indianapolis darstellt und trotzdem nicht minder Teil der Kultur der Gegend und weniger sehenswürdig ist. Der kleine Ort liegt in der Nähe von Goshen und ist gut mit dem Auto erreichbar. Schon auf der Fahrt merkt man den Übergang von der Stadt, über vereinzelte Gebäude inmitten von Feldern, bis hin zu weitläufig landwirtschaftlichen Gebieten. Shipshewana liegt mit seinen ungefähr 700 Einwohnern und einer Fläche von 3,46 Quadratkilometern in dieser Gegend. Anders als man denken könnte, hat die Stadt viel Interessantes zu bieten, vor allem, weil ein großer Teil der Einwohner amisch ist.
Die Amish People sind eine aus dem Christentum entstandene protestantische Glaubensgemeinschaft, deren größtenteils aus der Schweiz und Süddeutschland stammende Mitglieder im 18. Jahrhundert begannen, nach Amerika auszuwandern. Ihre Nachfahren leben noch heute in kleinen Gemeinschaften in Amerika und Kanada und bewahren die Bräuche ihrer Vorfahren. In ganz Amerika gibt es um die 241.000 Amish People, wovon 19 Prozent im Staat Indiana leben. Deshalb sind auch im Elkhart County, dem Landkreis von Goshen, vergleichsweise viele Amish People zu finden, 2012 waren es ungefähr 6.244, was etwas mehr als drei Prozent der gesamten dort lebenden Bevölkerung ausmacht. Die Anhänger dieser Gemeinschaft sind streng gläubig, leben nach strikten Regeln, trinken deshalb beispielsweise keinen Alkohol, und nutzen keine Errungenschaften der modernen Welt, wie Strom oder Autos. Viele amische Familien wohnen auf Bauernhöfen und bewegen sich auf Fahrrädern oder Kutschen fort, beides ein eher ungewöhnliches Bild, wenn man den Rest der Bevölkerung betrachtet. Vor einigen großen Discountern gibt es sogar Stellplätze für ihre Kutschen, doch nicht nur beim Einkaufen, sondern auch in anderen alltäglichen Situationen des Lebens, überschneiden sich die Lebensweisen dieser Gruppe mit denen der anderen Einwohner, weshalb ich sie mit ihrer traditionellen Kleidung in Restaurants oder auf der Rodelbahn zu Gesicht bekommen habe.
Außerdem sprechen sie eine Form von Deutsch, Pennsylvania Dutch, das auch englische Ausdrücke beinhaltet und haben ein eigenes Schulsystem, weshalb die Kinder in kleinen amischen Dorfschulen lernen. An einigen Gemeinschaften von amischen Bauernhöfen sind wir mit dem Auto vorbeigefahren und beim Anblick dieser Menschen scheint sich das weit verbreitete Bild von in der Zeit stehen Gebliebenen oder Zeitreisenden aus dem 18. Jahrhundert zu bestätigen, doch so ganz ohne zu bemerken, was in der Außenwelt geschieht, leben sie nicht. Schließlich nutzen sie Supermärkte und gehen in Restaurants essen.
Ein Einblick in das Leben dieser Religionsgemeinschaft in Shipshewana lohnt sich, wobei es meiner Meinung nach auch hier fraglich ist, wie viel in der Stadt wirklich noch den amischen Traditionen entspricht. Es lassen sich viele kleine Läden mit Souvenirs finden, und vor allem mit typischem Essen der Amish People. An der Echtheit der wirklich leckeren Donuts, eingelegten Gurken oder der Apfelbutter und des in allen Geschmacksrichtungen vorhandenen Käses zweifle ich keineswegs, allerdings leben die Amish traditionellerweise ohne Strom und könnten die Läden mit dem Licht und den Kühltheken somit gar nicht betreiben. Auf einer anderen Fahrt aus Goshen heraus, hat mir meine Gastmutter erklärt, wie man eine “echte” amische Farm von den anderen unterscheiden kann und eigentlich ist es ganz einfach: Man muss nur Ausschau danach halten, ob das Haus mit einer Stromleitung verbunden ist oder eben nicht.
Trotzdem hat mir Shipshewana gut gefallen, denn auch wenn ich nicht genau sagen kann, ob alles als amisch titulierte auch wirklich typisch und traditionell amisch war, habe ich echte Amish People gesehen. Und wenn sie etwas an ihrer Lebensweise ändern möchten und beispielsweise beginnen, Strom zu nutzen, muss das ja nicht zwingend als eine Infragestellung ihrer wirklichen Zugehörigkeit zu der Gemeinschaft genutzt werden, denn Traditionen ändern sich mit der Zeit und die Modernisierung ist kein neues Phänomen. Ob man das nun als Grund für einen Vorwurf sieht oder nicht, sei jedem selbst überlassen. Für mich persönlich war der Tag in Shipshewana auf jeden Fall ein Gewinn und mir ist bewusst, dass mich auf einer amischen Farm und Dorfschule ganz andere Eindrücke erwartet hätten.
Aber nicht nur der Bezug zu den Amish People hat die Stadt für mich so sehenswert gemacht, sondern auch ganz schlicht und einfach das Bild, welches sich meinen Augen zeigte. Wie ich vorhin schon beschrieben habe, könnte der Gegensatz zur Großstadt oder Metropole kaum noch deutlicher sein: Das Schlendern in den kleinen Gassen, links und rechts Holzhäuser, in denen sich kleine Shops und Restaurants befinden, hat mir auf seine eigene Art und Weise ein ganz besonders amerikanisches Flair vermittelt. Hier konnte ich die Kultur von einer ganz anderen Seite erleben.
Also, falls ihr mal in Shipshewana sein solltet, empfehle ich euch, auf jeden Fall in die “Risn Roll Bakery” für besonders leckere amische Donuts und die “Heritage Ridge Creamery”, wo es Käse in allen Formen und Farben zum Probieren gibt, zu gehen.
Das Leben in Goshen
Anknüpfend an die Beschreibung dieser beiden Extreme, möchte ich noch etwas genauer auf Goshen und das alltägliche Leben, an dem ich teilhaben durfte, eingehen.
Die Stadt hat in etwa 33.220 Einwohner und eine Fläche von 44.10 Quadratkilometern. Gemessen an den 333.000 Einwohnern und der fast sechsmal so großen Fläche Bielefelds scheint die Stadt auf den ersten Blick bedeutungslos, doch als County Seat von dem Verwaltungsbezirk Elkhart County und Universitätsstadt, hat sie bei mir trotzdem den Eindruck hinterlassen, von Wichtigkeit zu sein.
Neben den vielen Amish People, die in oder in der Nähe von Goshen leben, wohnen dort auch viele Menschen mit lateinamerikanischem Hintergrund. Sie machen ungefähr 30 Prozent der Bevölkerung der Stadt aus. Vor allem aus Mexiko ist die Einwanderungsrate sehr hoch, was für mich etwas paradox war, wenn man bedenkt, dass Indiana ein pro Trump Staat ist. Aus diesem Grund fand ich das Zusammenleben der Kulturen in Goshen sehr schön. Zudem ist natürlich nicht jeder Bewohner ein Republikaner, und auch ein Republikaner nicht gleich ein Rassist.
Die Größe der Stadt hat mir persönlich zugesagt, da sie definitiv nicht zu groß und voll ist, dennoch aber viele Möglichkeiten bietet, sei es im Hinblick auf die Freizeitgestaltung, Bildung oder Anderes. Natürlich habe ich Goshen eher als Besucherin kennengelernt. Allerdings hatte ich den Eindruck, dass die Stadt Einiges für ihre Einwohner bereithält, die somit nicht zwingenderweise für jede größere Besorgung in die nächstgrößere Stadt fahren müssen, wie das “Goshen College”, ein Krankenhaus, eine Bibliothek und Natur mit vielen Seen zum Entspannen.
In dem Zeitraum meines Aufenthaltes dort war es tiefer Winter und wegen einer Kältewelle in Teilen Amerikas konnte es in dem Gebiet um Goshen bis zu minus 30 Grad Celsius kalt werden. Tatsächlich war das aber kein Problem für mich, da ich die verschneite und zauberhafte Landschaft um mich herum, wie man sie in Deutschland nicht mehr zu sehen bekommt, toll fand. Sich viel draußen aufzuhalten war verständlicherweise keine gute Idee, aber im Laufe der Zeit wurde das Wetter wieder milder und der Schnee ist geschmolzen, sodass Spaziergänge oder Ausflüge in die Stadt wieder besser zu machen waren.
Die Innenstadt ist klein, aber schön und gemütlich und ich habe jeden kleinen Ausflug zum Besichtigen, Einkaufen oder Essen gehen genossen und mich gefühlt, als wäre ich in einen Film katapultiert worden, der in einer amerikanischen Kleinstadt mit all ihren Cafés, Kinos und winzigen Shops, spielt.
Die Infrastruktur hingegen, würde man aus deutscher Sicht bezogen auf den öffentlichen Verkehr als schlecht bezeichnen. Wie es für amerikanische Kleinstädte üblich ist, habe ich kein gut ausgebautes Nahverkehrssystem vorgefunden. Außer weniger Busslinien, die selten und unregelmäßig fahren, scheint es in Goshen so gut wie keinen öffentlichen Transport zu geben. Ohne ein Auto ist es also fast unmöglich sich in der Stadt fortzubewegen, was dazu führt, dass fast jeder ein eigenes besitzt. Wie schon angesprochen, fährt die Mehrheit der Schüler mit dem Auto zur Schule; der Parkplatz sieht so voll aus wie der vor einem Einkaufszentrum. Aber nicht nur meine Austauschschülerin hatte ein eigenes Auto. Ihre Mutter, ihr Vater und ihre Großmutter hatten jeweils eins, was im Vergleich zu deutschen Familien, die meist ein oder zwei Autos haben, sehr viel oder fast schon übertrieben erscheint, aufgrund der Infrastruktur in Goshen aber fast unentbehrlich für jemanden ist, der arbeitet und viel unterwegs ist. Dazu kommt, dass man Fahrräder fast gar nicht nutzt, und wenn, dann nur zum Freizeitspaß. Zu Fuß zu gehen schien für die Menschen auch keine Option für kurze Strecken zu sein, was aber bestimmt auch dem Wetter geschuldet war.
Einmal war ich mit meiner Austauschschülerin in einem großen Secondhand-Geschäft, und um nicht zum gegenüberliegenden Supermarkt laufen zu müssen, den nur ein Parkplatz von uns trennte, haben wir das Auto auf dem Parkplatz umgeparkt. In diesem Punkt meine ich eine andere Mentalität als die deutsche kennengelernt zu haben, und so alltäglich dieses Erlebnis auch war, ich werde mein Erstaunen darüber so schnell nicht vergessen.
Das Jugendleben
Mit dem Aspekt der Kultur des Autofahrens geht auch einher, dass Jugendliche damit oft unterwegs sind und sich mit Freunden treffen, um sich etwas zu Essen zu holen oder einfach durch die Gegend zu fahren und die Zeit zu genießen. Oft hat meine Austauschschülerin mich mit Freunden im Auto zu Starbucks oder Target mitgenommen, wo wir viel Spaß hatten. Target ist eine riesige Geschäftskette in Amerika und in den Läden, sogenannten „Grocery Stores“, wird von Essen über Gartenzubehör und Kleidung bis hin zu elektronischen Geräten wirklich alles verkauft. Außerdem gibt es in Amerika sehr viele „Drive Thrus“, bei denen man sich mit dem Auto in einer Schlange anstellt, um Essen oder Getränke zum direkten Weiterfahren zu kaufen.
Ansonsten scheint es mir, dass Jugendliche in Deutschland und Amerika ihre freie Zeit ziemlich ähnlich gestalten, sprich sich zu Hause treffen oder eben etwas unternehmen. Es war definitiv eine lustige Zeit, in der ich mit meiner Austauschschülerin und Freunden Filme geguckt, im Auto zu Musik gesungen und über alles und nichts geredet habe.
Auch Alkohol und Drogen scheinen eine Rolle in dem amerikanischen Jugendleben zu spielen, obwohl ich davon nur erzählt bekommen habe. Bei mir wurde der Eindruck erweckt, dass es zwar viele junge Menschen gibt, die sich ausprobieren möchten, vor allem im Rauchen von E-Zigaretten, aber auf der anderen Seite auch genauso viele, die sich davon fernhalten, was auch damit zu tun haben könnte, dass der Konsum von Alkohol in Amerika erst ab 21 erlaubt ist und, dass die Eltern häufig strenger sind. Damit geht einher, dass es keine Möglichkeit gibt, für Jugendliche in Clubs feiern zu gehen und auch der Alkohol- und Drogenkonsum, der bei vielen gerade aufgrund des strikten Verbots einen besonderen Reiz zu haben scheint, birgt selbstverständlich ein höheres Risiko.
Für mich war es sehr seltsam festzustellen, wie streng Alkohol verboten ist und wie schnell man dafür Auto fahren darf, was in Deutschland fast umgekehrt zu sein scheint. Beides vermittelt einem jungen Menschen meiner Meinung nach das Gefühl, ein Stück weit mehr Teil der Gesellschaft und vor allem erwachsener zu sein und es ist krass, wie sehr sich die Sichtweisen von zwei Staaten auf diese zwei Aspekte unterscheiden können. Während es für einen deutschen Jugendlichen unvorstellbar ist, schon mit 16 alleine mit dem Auto durch die Straßen seiner Stadt zu fahren, denkt der amerikanische Jugendliche das gleiche über das Kaufen von Bier mit dem Ausweis eines Sechzehnjährigen.
Und doch ähneln sie sich und leben das Leben eines normalen jungen Menschen und gehen zur Schule, machen Sport, essen Frozen Joghurt, gehen ins Kino oder in Restaurants und backen Kekse.
Das Familienleben und der Konsum
Essen gegangen bin ich mit meiner Gastfamilie auch sehr häufig, was für mich etwas neues war, denn hier in Deutschland macht meine Familie das äußerst selten, wohingegen das gemeinsame Essen in Restaurants auch unter der Woche Teil des Familienlebens für meine Gastfamilie ist. Offen gesagt, kam mir das Auto manchmal, nicht nur bezogen auf diesen Aspekt, wie die Erweiterung des Wohnzimmers vor. Das meine ich aber definitiv positiv, denn mir hat es wirklich gut gefallen, wie die Familie sich Zeit füreinander genommen und auch mich als Austauschschülerin mit einbezogen hat.
Das Essen an sich unterscheidet sich ebenfalls von dem deutschen, denn ich konnte feststellen, dass es das Vorurteil des ungesünderen Essens nicht so ganz ohne Grund gibt. Zwar wurde in meiner Gastfamilie gerne und viel gekocht, auch gesund, allerdings gab es immer Snacks für zwischendurch. Eine der Küchenablagen war immer überfüllt mit Chips, Popcorn und Süßigkeiten und es wurde sich auch reichlich bedient. Außerdem waren Burger und Pizzen keine Seltenheit zum Abendessen. Ich möchte den Amerikanern zwar nichts unterstellen, aber ich habe das Gefühl, dass generell mehr gegessen wird. Ein guter Indikator dafür sind zum Beispiel die zwei riesigen Kühlschränke und die zwei Gefriertruhen, die meine Gastfamilie hat, obwohl ich auch denke, dass dafür seltener eingekauft wird, als in Deutschland, da man einfach mehr Aufbewahrungsmöglichkeiten hat.
Zu dem Essen kann ich insgesamt sagen, dass ich es sehr lecker finde und es genossen habe, es aber definitiv nicht vermisse. Mir kam alles extra riesig vor, sei es ein Getränk bei Starbucks, ein Burger oder ein Frozen Joghurt.
Außerdem kam mir das Kaufverhalten, vor allem im Hinblick auf das Essen, ziemlich bedenkenlos und die Maschinerie einer riesigen Konsumgesellschaft unterstützend, gefördert durch gigantische Grocery Stores und Drive Thrus, vor. Das ist in Deutschland auch nicht viel besser, aber ein beträchtlicher Unterschied ist definitiv der Verbrauch von Plastiktüten. Ich habe schon davon gehört, dass man beim Einkaufen in Amerika sehr viele Tüten aus Plastik nutzt, allerdings wurde mir das Ausmaß dessen erst richtig bewusst, als ich das erste Mal mit meiner Gastmutter in einem Grocery Store, einem gigantischen Supermarkt, einkaufen war und es an der Kasse eine Angestellte gab, die ausschließlich dafür zuständig war gefühlt jedes einzelne Produkt in eine kleine und dünne Plastiktüte einzupacken. Meiner Meinung nach wäre es so einfach, sich ein paar Jutebeutel zum Einkaufen anzuschaffen, doch mir scheint das Bewusstsein dafür einfach viel zu klein zu sein. Laut dem Tagesspiegel liegt der jährliche Verbrauch von Plastiktüten in Amerika bei ungefähr 100 Milliarden, eine immense Zahl, die sogar noch größer wirkt, wenn man bedenkt, wie viel weniger Einwohner das Land verglichen dazu hat. Aktuell sind es ungefähr 327,2 Millionen.
Mein Fazit zu dem Austausch
Mir ist zwar sehr deutlich geworden, dass die Gesellschaft an einigen Stellen vom Konsum geleitet wird und das Umweltbewusstsein gering ist, aber, dass es, wie eigentlich überall auf der Welt, kein Böse und Gut, kein Schwarz und Weiß gibt. Es gibt genauso viele positive Gesichtspunkte in der Gesellschaft, die das Land gemeinsam mit dem Negativen einzigartig machen.
Was mir beispielsweise besonders gut gefällt, ist die Gastfreundschaft, mit der ich aufgenommen wurde. Sehr gerne blicke ich auf die Zeit mit meiner Gastfamilie und in der Schule zurück, die eine unvergessliche war. Auch wenn die Menschen zum Teil oberflächlich wirken und es auch sein können, sind sie sehr herzlich und offen und wenn man jemanden besser kennenlernt, wird diese Ebene abgelöst. Auch mit Amerikanern kann man ehrliche und offene Gespräche führen und auch sie schauen kritisch auf ihre Gesellschaft.
Ich habe die Zeit mit meiner Gastfamilie immer sehr genossen, denn sie haben mich wirklich in ihre Familie aufgenommen und haben mich nicht nur in Restaurants oder ins Kino mitgenommen, sondern auch am ganz alltäglichen Leben, wie einkaufen oder in die Kirche zu gehen, teilhaben lassen. Ich habe schnell gemerkt, dass sie sich wirklich für meine Kultur interessieren; oft haben wir uns über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Amerika und Deutschland unterhalten und immer, wenn ich nach der Schule erzählt habe, wie der Tag gewesen ist oder, wenn ich mit meiner Gast-Oma Karten gespielt habe, hatte ich das Gefühl, ein Teil der Familie zu sein. Natürlich hatte ich bessere und schlechtere Tage, aber um Heimweh zu haben, hatte ich gar keine Zeit bei all den neuen Eindrücken und Erfahrungen.
Ein anderer Aspekt, den man in Deutschland nicht so schnell findet, ist der starke Zusammenhalt, den ich in dieser offensichtlichen Form zum ersten Mal bei einem amerikanischen High-School-Basketballspiel erlebt habe.
Auch generell ist der Besuch einer High School eine für mich wertvolle Erfahrung, denn die vielen Unterschiede haben mir gezeigt, wie sehr Bildung vom Gesetzgeber abhängt und wie unterschiedlich dieser Begriff aufgegriffen und interpretiert werden kann. Diese Erkenntnis hat mir auch gezeigt, wie sehr ich die eigenständige Erarbeitung von Unterrichtsinhalten, die in Deutschland vor allem durch Unterrichtsdiskussionen erfolgt, wertschätzen kann. Diese Form des Lernens hat mir in Amerika meistens gefehlt, obwohl sie meiner Meinung nach essentiell für die Bildung ist.
Insgesamt kann ich sagen, dass die Erfahrung mich gelehrt hat, nicht alles so einfach hinzunehmen, sondern aus einem anderen Blickwinkel auf gesellschaftliche Themen zu schauen, auch hier in Deutschland, mir aber auch darüber bewusst zu sein, dass ich Gast in einem anderen Land bin und keine voreingenommenen Urteile zu fällen, sondern mich auf die Kultur einzulassen und wertzuschätzen, was das Land mit den darin lebenden Menschen, seiner Kultur, seiner Geschichte und dem Klima zu bieten hat. Damit meine ich nicht, dass man sich als Gast in einem anderen Land keine Meinung über bestimmte Aspekte bilden sollte, man sollte nur nicht schon mit der Einstellung ankommen, dass im eigenen Land sowieso alles besser ist. Stattdessen sollte man sich einfach auf das Gastland einlassen. In diesem Text bin ich zwar an mehreren Stellen auf bestehende Vorurteile gegen Amerikaner eingegangen, jedoch ausschließlich aus dem Grund, dass es für mich persönlich interessant war, herauszufinden, wie viel sie wirklich aussagen. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass man natürlich immer jemanden finden wird, der in ein bestimmtes Vorurteil passt, sozusagen in das Bild eines stereotypisierten Amerikaners, dass man aber auch immer jemanden finden wird, der nicht in diese Schublade passt. Letztendlich sprechen die meisten Vorurteile, wie das des ungesunden Essens oder der Oberflächlichkeit, gesellschaftliche Themen an, die sich von denen unseres Landes unterscheiden, die allerdings keineswegs auf jede in dieser Gesellschaft lebende Person zutreffen. So ist es ja im Endeffekt immer mit Vorurteilen: Wenn man will, findet man schnell Beweise dafür, dass sie wahr sind.
Doch der Austausch hat mir nicht nur geholfen, charakterlich zu wachsen, sprich offen und gespannt auf neue Menschen und neue Kulturen zuzugehen, dankbar für all das zu sein, was ich erleben darf und ein wenig selbstständiger durch die Welt zu laufen. Auch im Sprachlichen habe ich eine ungemeine Entwicklung gemacht, denn auf einen Austausch zu fahren und gezwungen zu sein, in einer anderen Sprache zu kommunizieren, macht es unmöglich, sie nicht besser zu lernen. Nicht nur mein Ausdrucksvermögen hat sich stark erweitert, ich kann jetzt auch sprechen, ohne vorher darüber nachzudenken und bin im Englischen viel spontaner. Man erlangt automatisch Kenntnisse, die man im Unterricht nicht so leicht erwerben könnte und der Spaß am Lernen der Sprache wächst mit den Tagen, an denen man ihr ausgeliefert ist.
Meiner Meinung nach lohnt es sich auf alle Fälle, an einem Austausch teilzunehmen. Dieser hat mir insbesondere gut gefallen, weil ich schon immer gerne nach Amerika reisen wollte und ich so die Möglichkeit hatte, sogar acht Wochen lang in die Kultur einzutauchen und am Schulleben teilnehmen zu können, ohne die Schule in Deutschland zu vernachlässigen. Außerdem findet das Programm in beide Richtungen statt, weshalb meine Austauschschülerin im Sommer drei Wochen bei mir verbracht hat.
Der Austausch hat definitiv Spaß gemacht und ich würde ihn jedem weiterempfehlen, der Lust hat seine Englischkenntnisse zu erweitern, neue Leute kennenzulernen und mal so ganz aus dem eigenen Alltag gerissen zu werden.